Neue Nationalgalerie Berlin 40 Jahre "Tempel der Moderne"
13.09.2008, 12:39 Uhr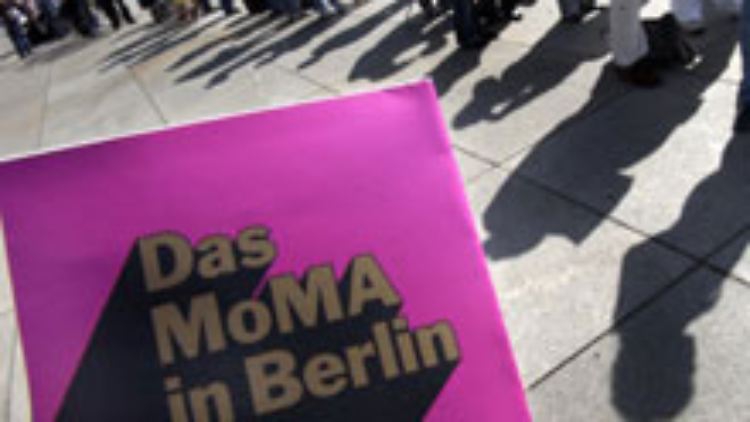
Wer die Moma-Ausstellung sehen wollte, musste viel Geduld mitbringen ...
"Zur Freude der Menschen, im Dienste der Kunst und des Geistes" soll die Neue Nationalgalerie in Berlin nach dem Willen ihres Erbauers Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) dienen. Nun feiert sie ihren 40. Geburtstag.
"Zur Freude der Menschen, im Dienste der Kunst und des Geistes" soll die Neue Nationalgalerie in Berlin nach dem Willen ihres Erbauers Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) dienen. Das hatte der 1937 in die USA emigrierte Architekt dem Museum bei der Grundsteinlegung mit auf den Weg gegeben. An diesem Montag feiert sie ihren 40. Geburtstag. Dazu gibt es einen "offenen Gesprächsabend" mit Künstlern, Architekten und Zeitzeugen sowie Filmvorführungen und Gastronomie auf der Terrasse.
Der Bau am heutigen Kulturforum unweit des Potsdamer Platzes kostete 26 Millionen Mark (rund 13 Millionen Euro) und - heute fast unvorstellbar - blieb damit sogar unter den veranschlagten Kosten. Zur Sammlung der Neuen Nationalgalerie, die bis dahin die modernen Werke in der Orangerie des Schlosses Charlottenburg zeigte, gehören Hauptwerke von Picasso, Kirchner, Beckmann, Dix, Klee, Bacon, Newman, Stella und Richter. Manche davon riefen allerdings auch schon mal die Aggressionen von Besuchern hervor. So attackierte 1982 ein 29 Jahre alter Student das weltberühmte Gemälde "Wer hat Angst vor Rot, Gelb und Blau" von Barnett Newman und beschädigte es mit einem stumpfen Gegenstand erheblich.
"Wir brauchen Aufgeschlossenheit"
Der "Tempel der Moderne" im zeitgenössischen Pavillonstil aus Glas, Stahl und Beton war am 15. September 1968 in einem großen Festakt vom damaligen Regierenden Bürgermeister Klaus Schütz (SPD) und, wie es im geteilten Berlin noch üblich war, auch in Anwesenheit alliierter Stadtkommandanten eröffnet worden. Schütz betonte dabei, begleitet von den 1968 obligaten Studentenprotest-Flugblättern, die Bereitschaft Berlins, allem Neuen eine Chance zu geben - "wir brauchen diese Aufgeschlossenheit".
Schon die großzügige Formgestaltung, die die Nationalgalerie selbst zu einem Kunstwerk und Klassiker der Architekturgeschichte machte, erregte seinerzeit Aufsehen. Den künstlerischen Auftakt bildete damals eine spektakuläre Piet-Mondrian-Retrospektive. Später folgten so herausragende Ausstellungen wie die Retrospektiven zu Yves Klein (1976), Ernst Ludwig Kirchner (1980), Rebecca Horn (1994), Georg Baselitz (1996) und Paul Gauguin (1999) oder die großen Schauen des New Yorker MoMA (2004) mit den spektakulären Besucherschlangen und des Metropolitan Museum of Art (2007). Nicht geringen Anteil an so manchen Ausstellungen und Neuerwerbungen hatten die Freunde der Neuen Nationalgalerie, jahrzehntelang angeführt von Peter Raue, der das Amt in diesem Jahr an die frühere Kulturstaatsministerin Christina Weiss übergeben hat.
Die Neue Nationalgalerie war in der seinerzeit noch politisch geteilten Stadt auch als Gegenstück zur Alten Nationalgalerie auf der Museumsinsel in Ost-Berlin gedacht. In der Nachbarschaft am Kulturforum (mit dem angrenzenden Potsdamer Platz) befinden sich die Gemäldegalerie Alter Meister, die Philharmonie, die Staatsbibliothek, das Kunstgewerbemuseum und das Musikinstrumentenmuseum - West-Berlin wollte hier als "Frontstadt" hart an der Mauer und im "Schaufenster der freien Welt" Kulturflagge zeigen in bewusster Konkurrenz zu der sich so nennenden und auch kulturell mit einem Großteil der alten Berliner Museumsschätze auftrumpfenden "Hauptstadt der DDR". Nach dem Fall der Mauer und der deutschen Wiedervereinigung wurden auch die Bestände der beiden Nationalgalerien in der neuen alten Hauptstadt vereint mit mehr als 5000 Gemälden und etwa 1300 Skulpturen des 19. und 20. Jahrhunderts.
Schließen schmerzlicher Lücken
Nach dem letzten Krieg sollte mit der neuen Sammlung in der Nationalgalerie auch die schmerzliche Lücke geschlossen werden, die die Nationalsozialisten gerissen hatten, als sie 1937 die moderne Abteilung der Nationalgalerie mit Werken unter anderem von Czanne, van Gogh und Munch schlossen und auf dem internationalen Kunstmarkt verschleuderten oder auch gleich zerstörten. Auch der Krieg richtete verheerende Schäden unter den kostbaren Beständen an, vieles verbrannte im Flakbunker am Zoo, andere wertvolle Gemälde verschwanden als Beutekunst bei den Siegern, vor allem in der Sowjetunion.
Manches gaben sie wieder zurück, vieles lagert noch heute bei ihnen, eine der Hauptsorgen und -aufgaben des neuen Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger, und des künftigen Nationalgalerie-Direktors Udo Kittelmann, der am 1. November von Frankfurt am Main nach Berlin wechselt.
Mehr moderne Kunst
Eine andere Mammutaufgabe dürfte die Verlagerung der benachbarten Gemäldegalerie Alter Meister auf die Museumsinsel sein, die zwar noch in einiger Ferne, aber so gut wie beschlossen ist. Dann soll das Kulturforum am Tiergarten endgültig zum "Forum der Moderne" werden. Aber Berlin kann von Kunst nicht genug bekommen und will neben dem Hamburger Bahnhof (Museum der Moderne mit Beuys und Warhol) auch noch eine neue staatliche Kunsthalle für zeitgenössische Künstler errichten - um ein "modernes Gegengewicht" gegen "ewige Publikumsrenner" wie das Pergamonmuseum und das benachbarte Ägyptische Museum mit der Büste der Königin Nofretete zu schaffen. Dabei gibt es ja auch schon die Berggruen-Sammlung mit 90 Picassos und Klees am Charlottenburger Schloss oder das Helmut-Newton-Museum am Bahnhof Zoo - aber das ist schon wieder eine andere "Berliner Museumsgeschichte".
Quelle: ntv.de, Wilfried Mommert, dpa









