Bilderserien







































































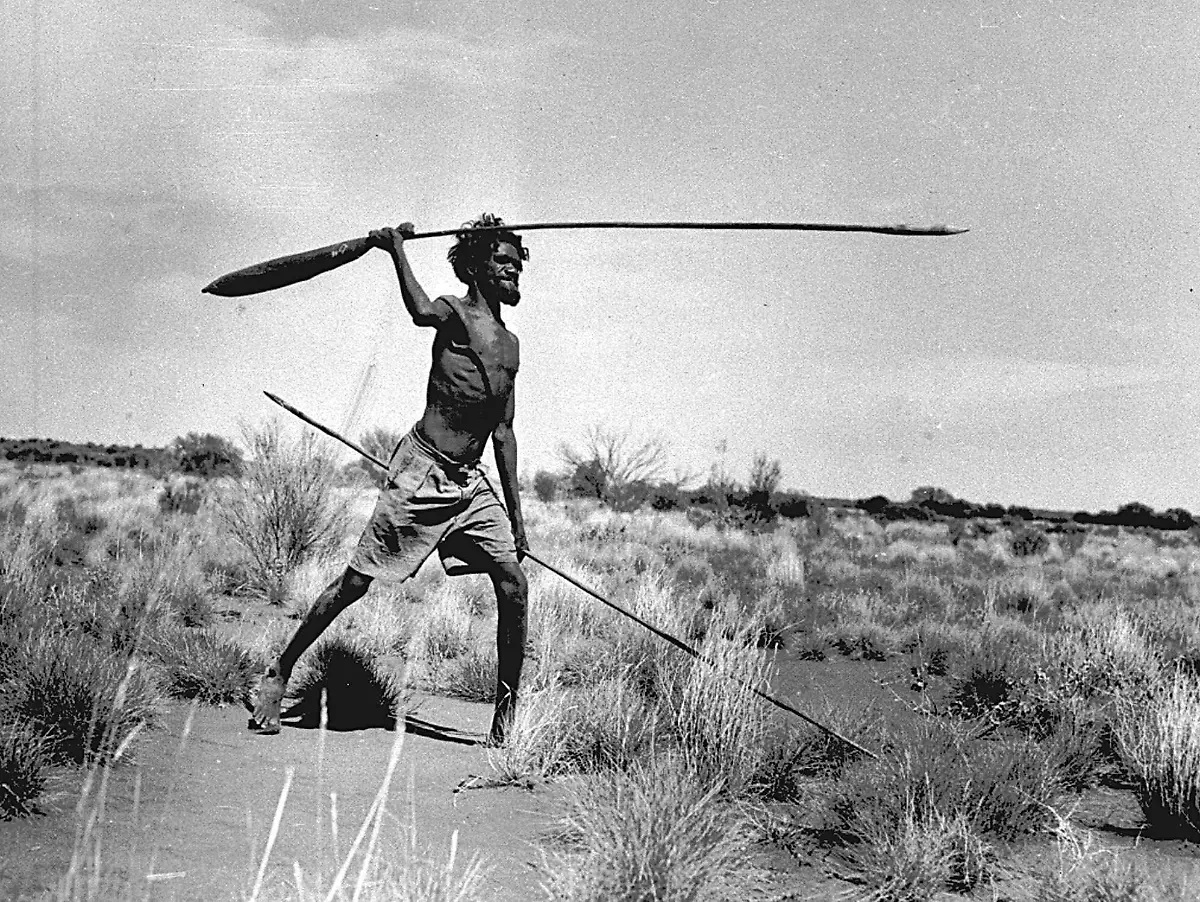
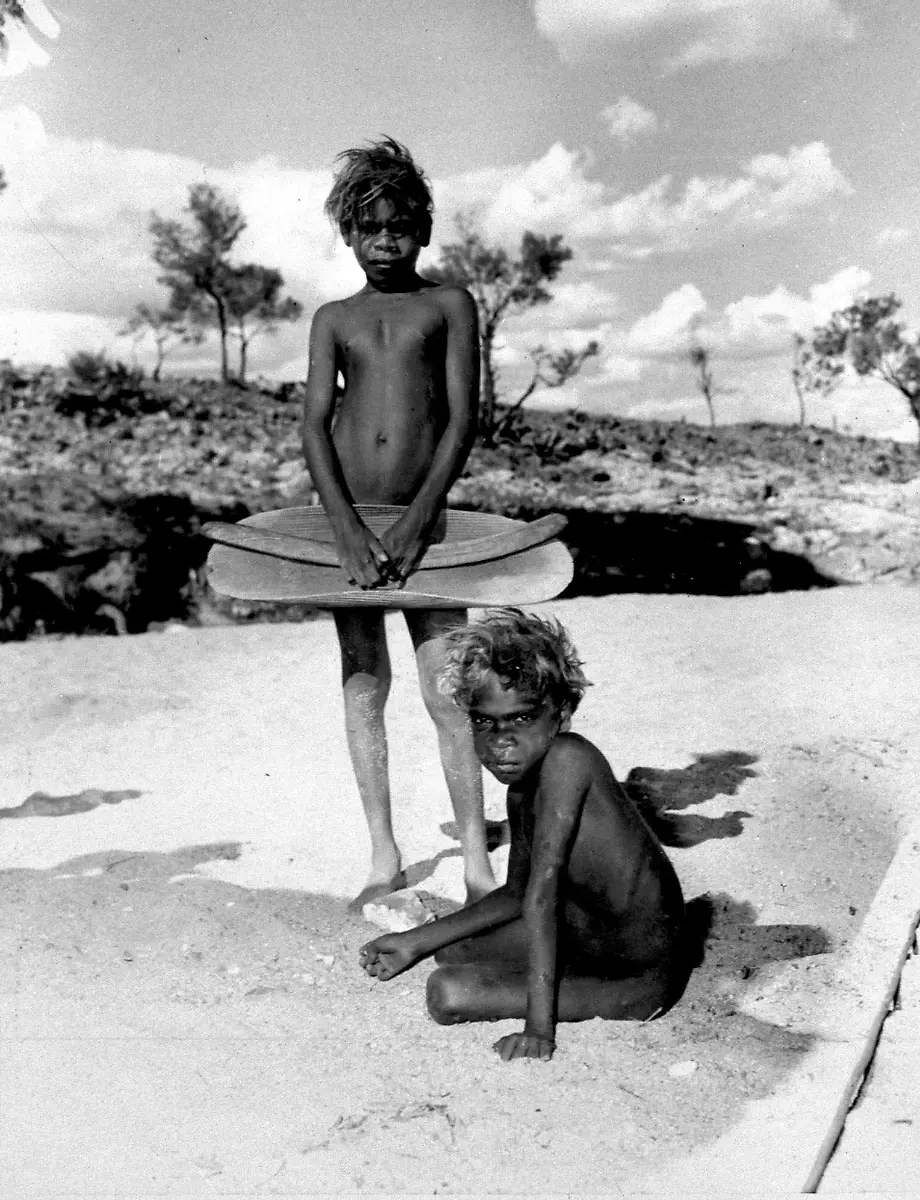

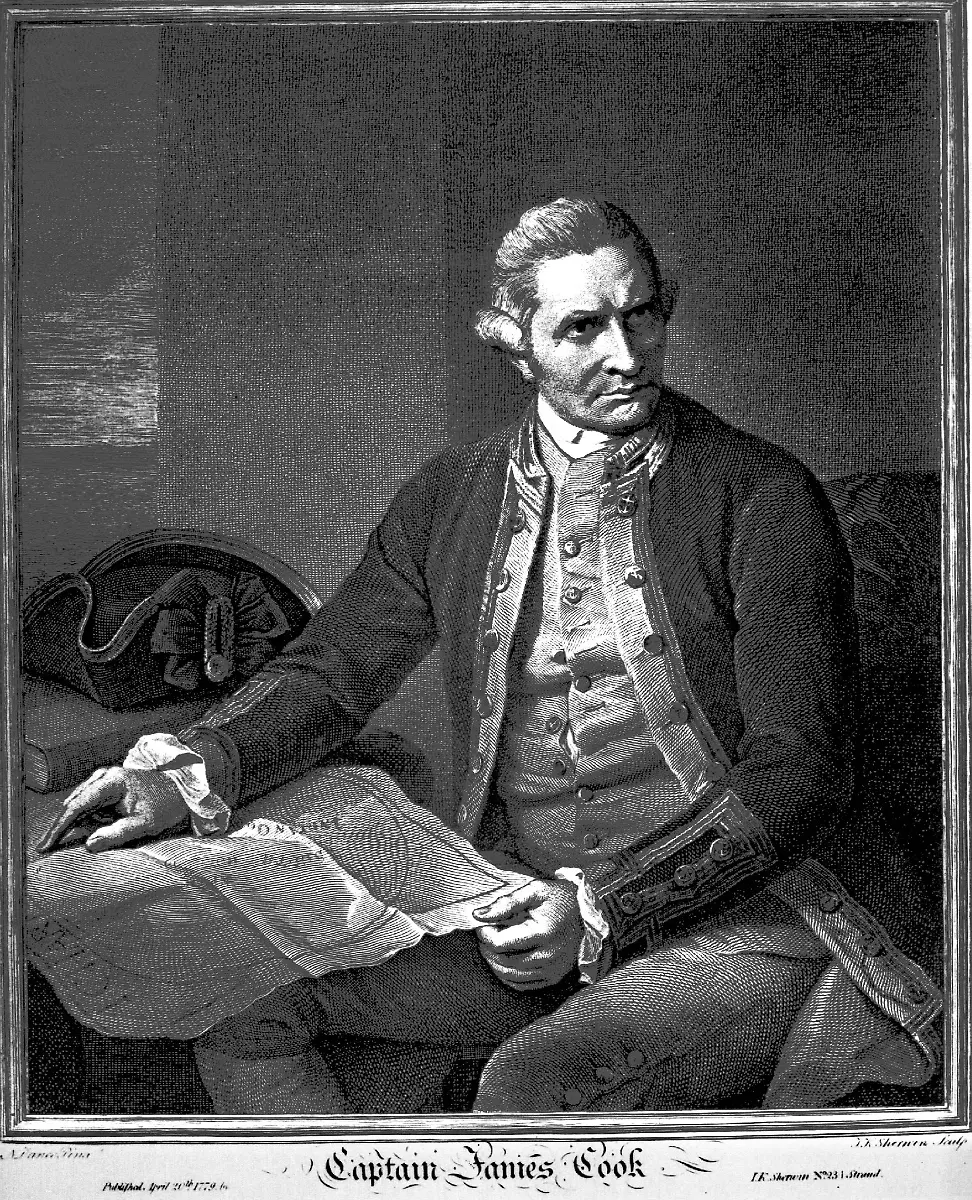

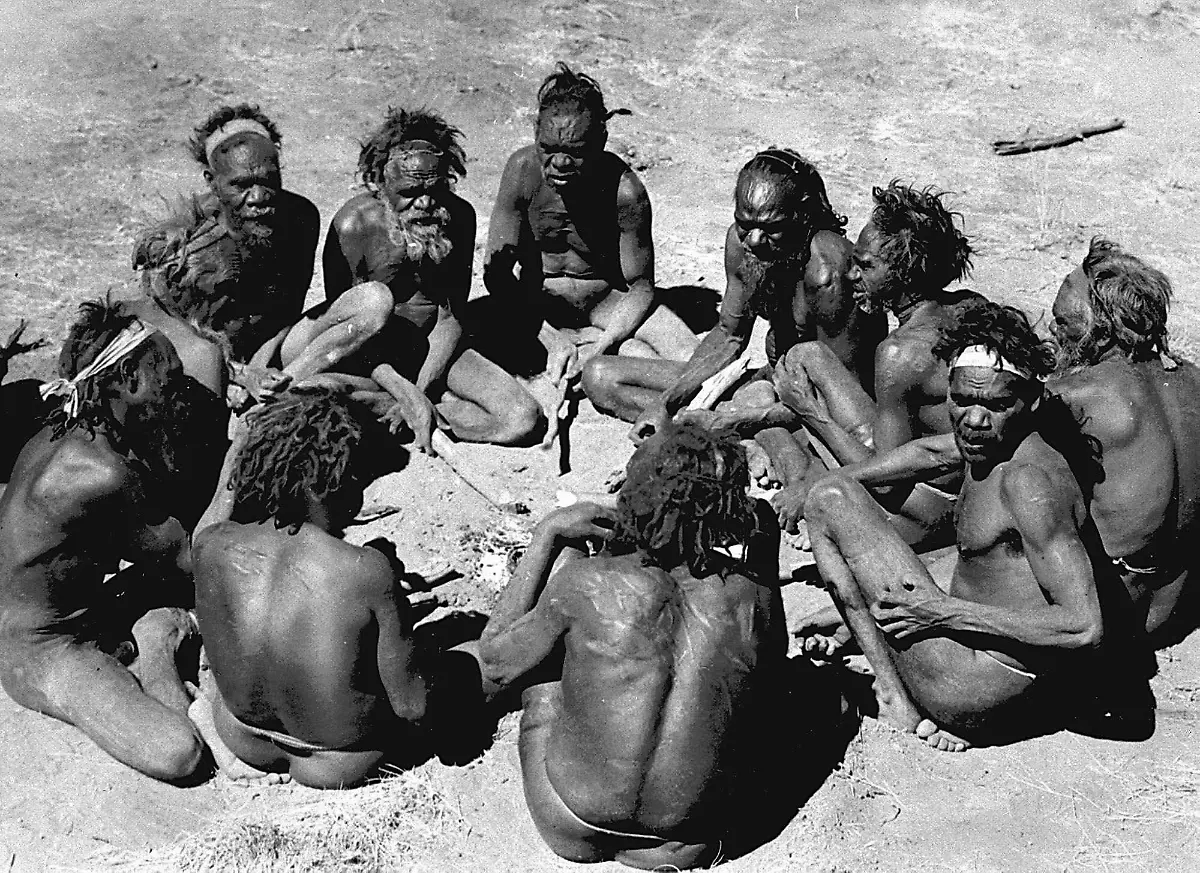













Australien - Land und KontinentKorallenriffe, Koalas und krasses Klima
16.05.2023, 08:00 Uhr
Auch heute ist eine Reise nach "Down under", wie Australien auch genannt wird, trotz schneller Flugzeuge für uns immer noch sehr zeitraubend und das Land erscheint uns exotisch und unbekannt. Das beginnt schon mit den Landeskenntnissen. Denn: Was ist die Hauptstadt von Australien?