Bilderserien


















































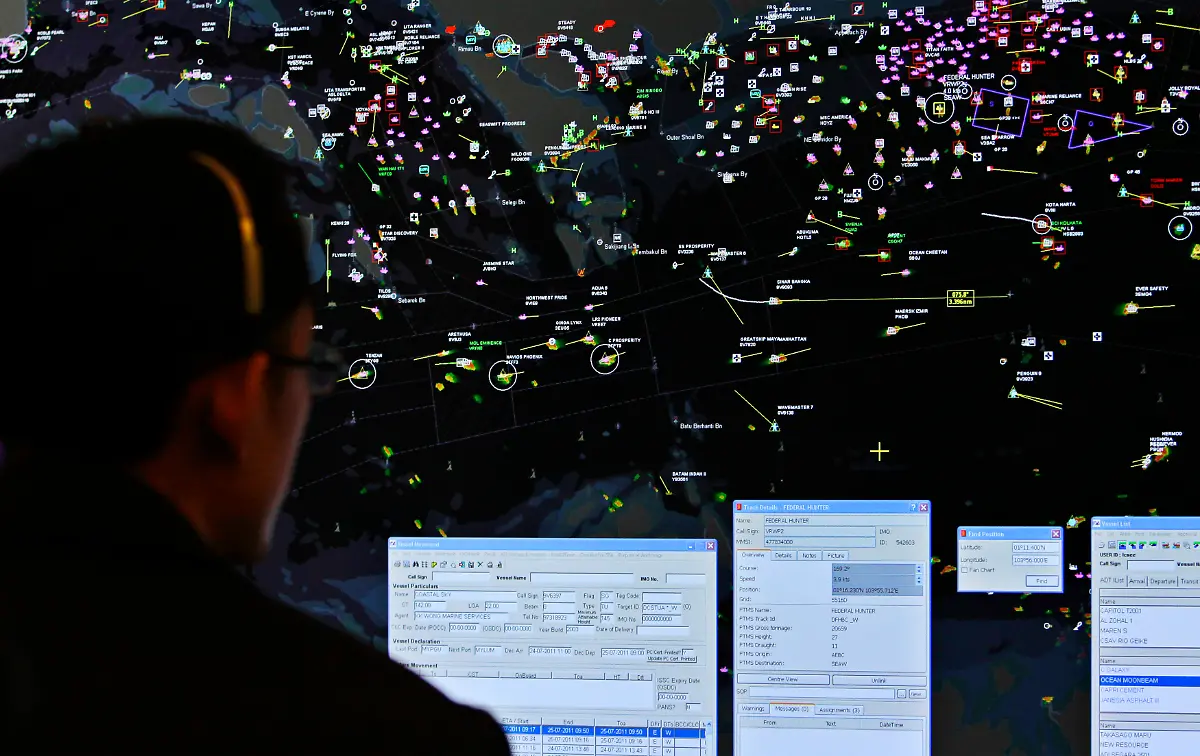






























Menschheit knackt neue MilliardenmarkeNummer 7.000.000.000 ist da
31.10.2011, 07:30 Uhr
Jedes Jahr wächst die Weltbevölkerung in der Größenordnung Deutschlands. Jede Sekunde kommen etwa drei neue Erdenbürger hinzu. Zwischen 1960 und 2000 hat sich die Zahl der Menschen verdoppelt - nun ist die Sieben-Milliarden-Marke überschritten. Das bringt große Probleme mit sich. Wie viele Menschen kann die Erde satt machen?