Bilderserien




























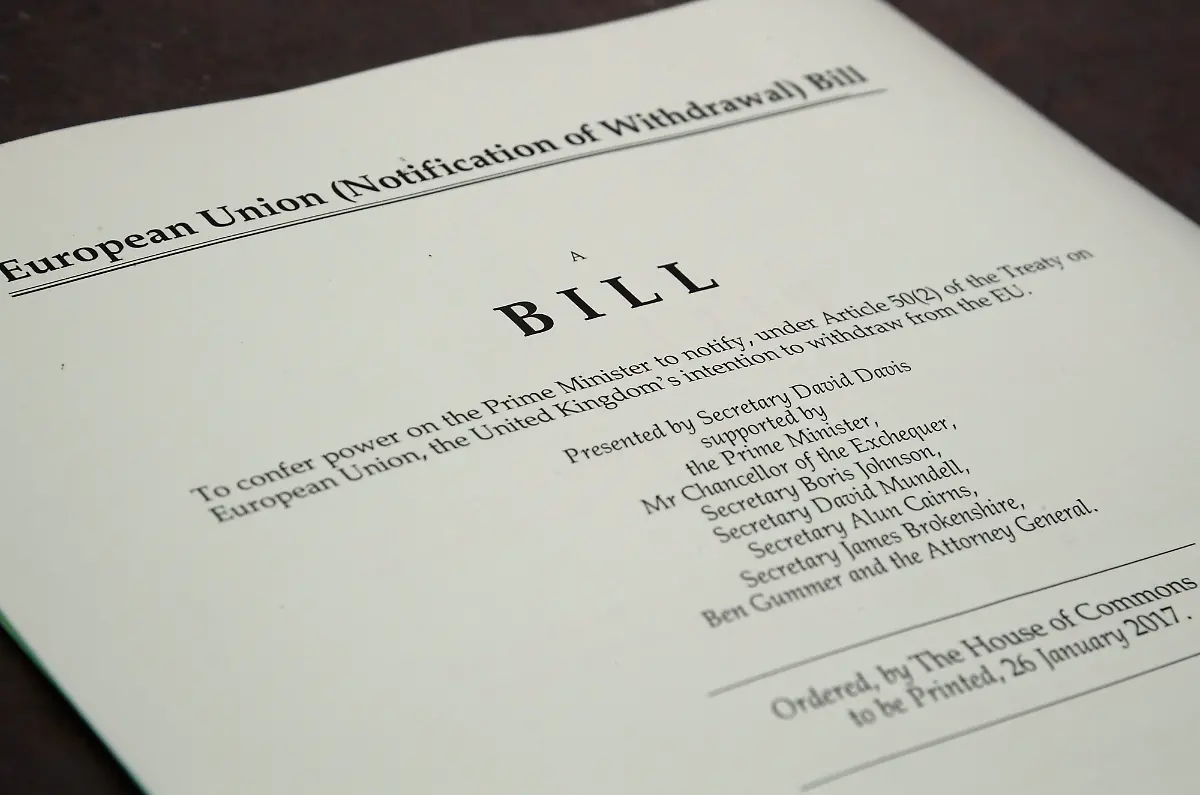







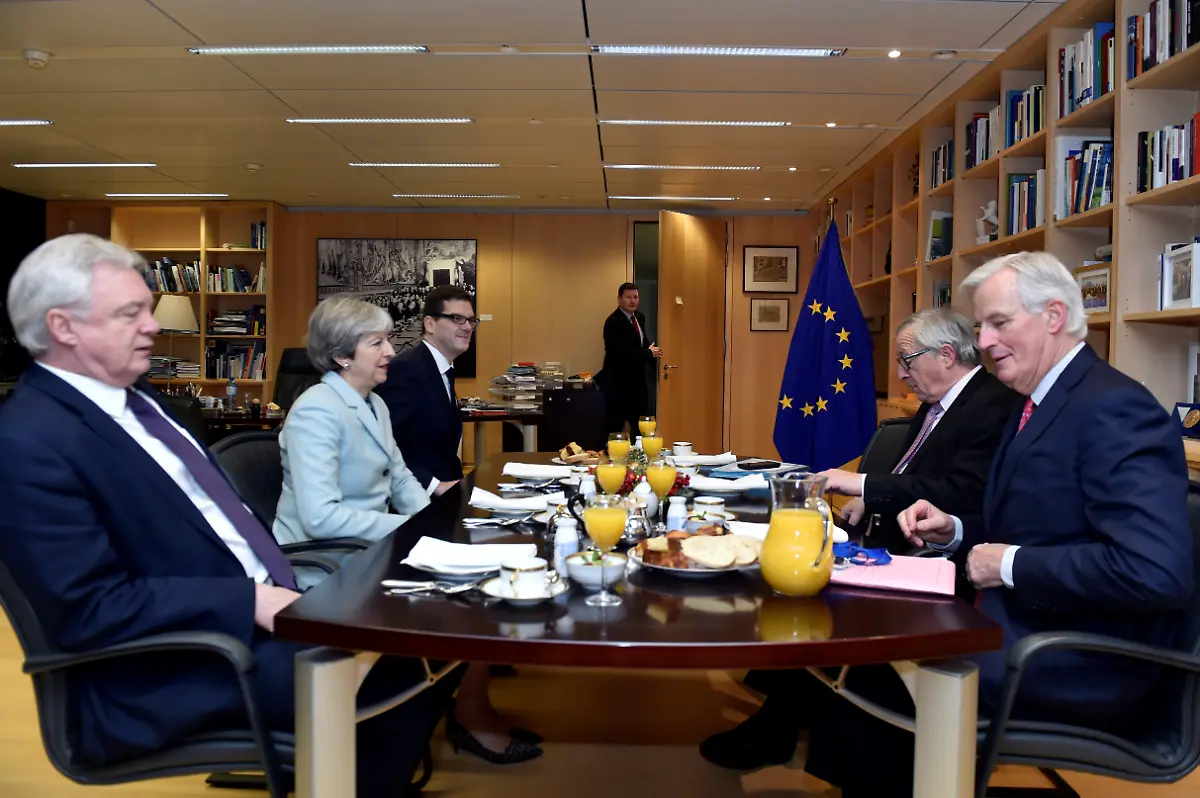

























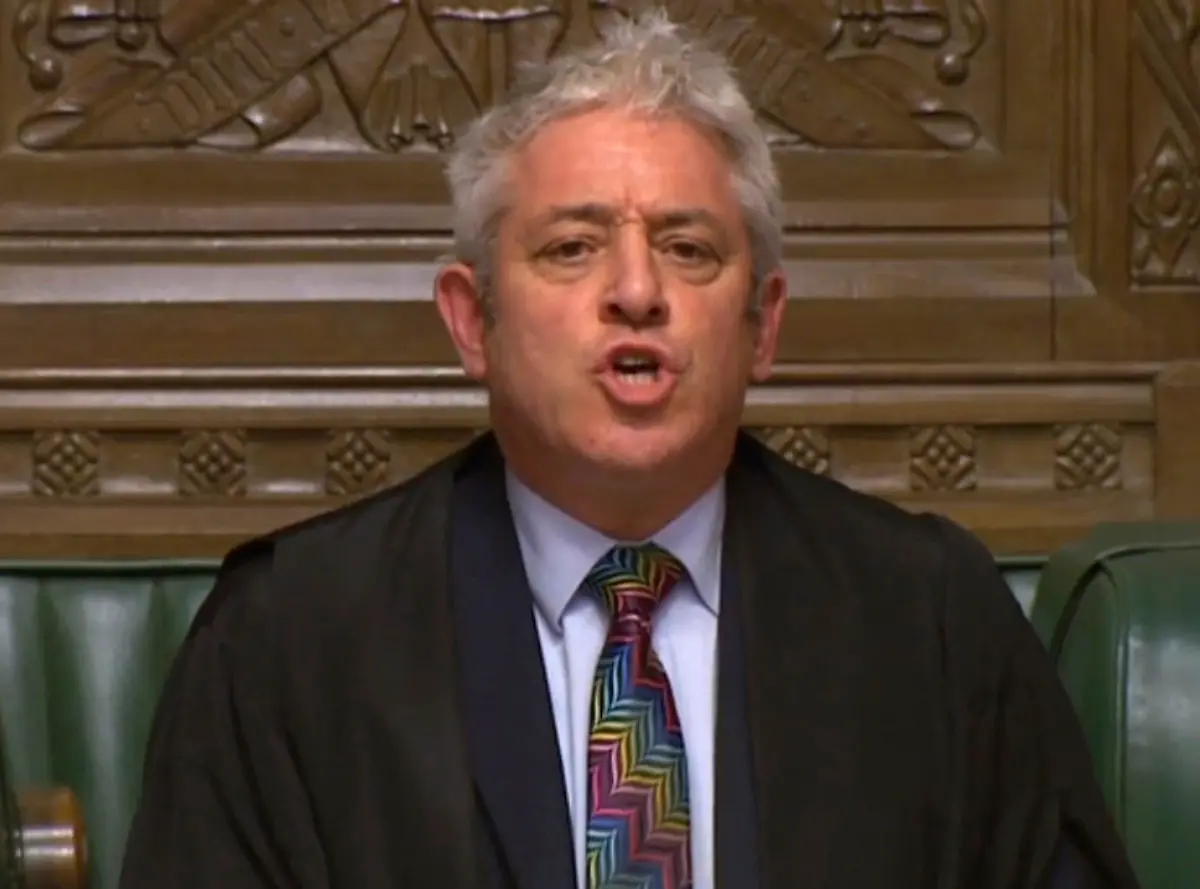










































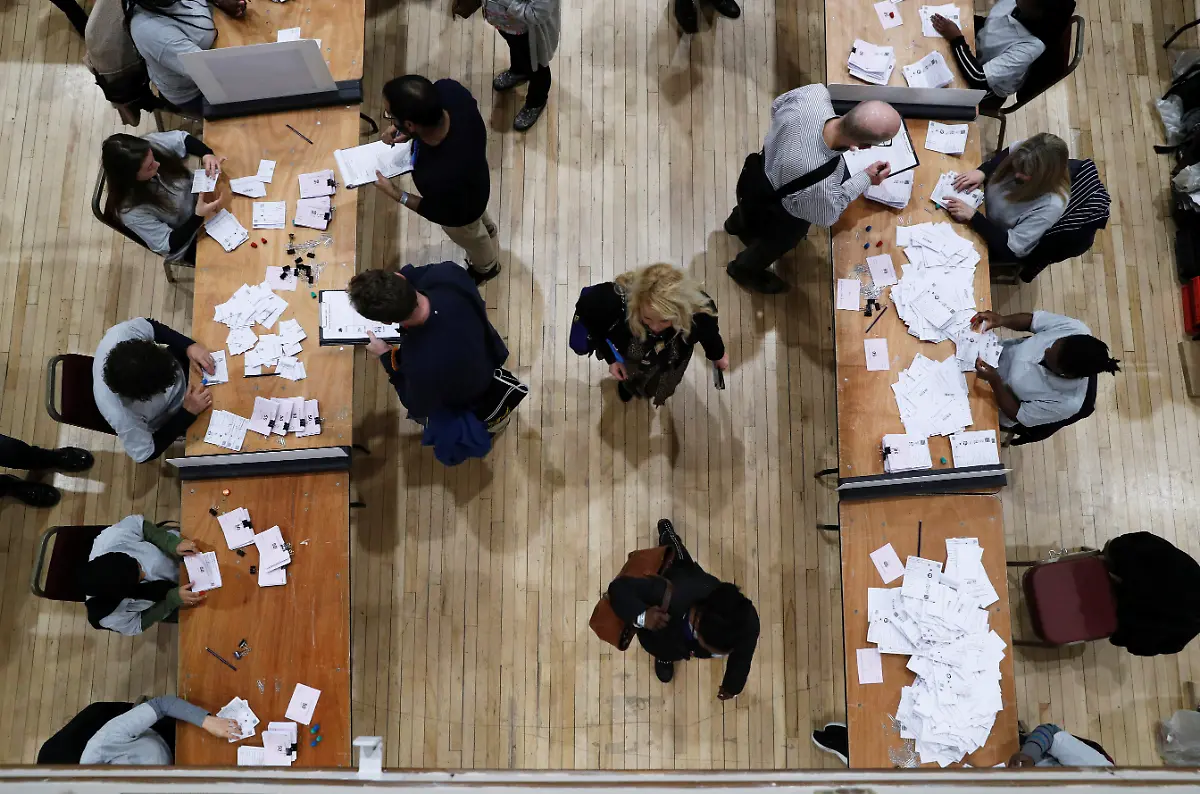













Zähe Scheidung Wie es zum Brexit-Drama kam
31.01.2020, 12:02 Uhr
Großbritannien hat die Europäische Union verlassen. Mehr als dreieinhalb Jahre nach dem Brexit-Votum wurde der Austritt Realität. Doch wie konnte es überhaupt so weit kommen?