Was Ronald Pofalla nicht sagteDie offenen Fragen der NSA-Affäre
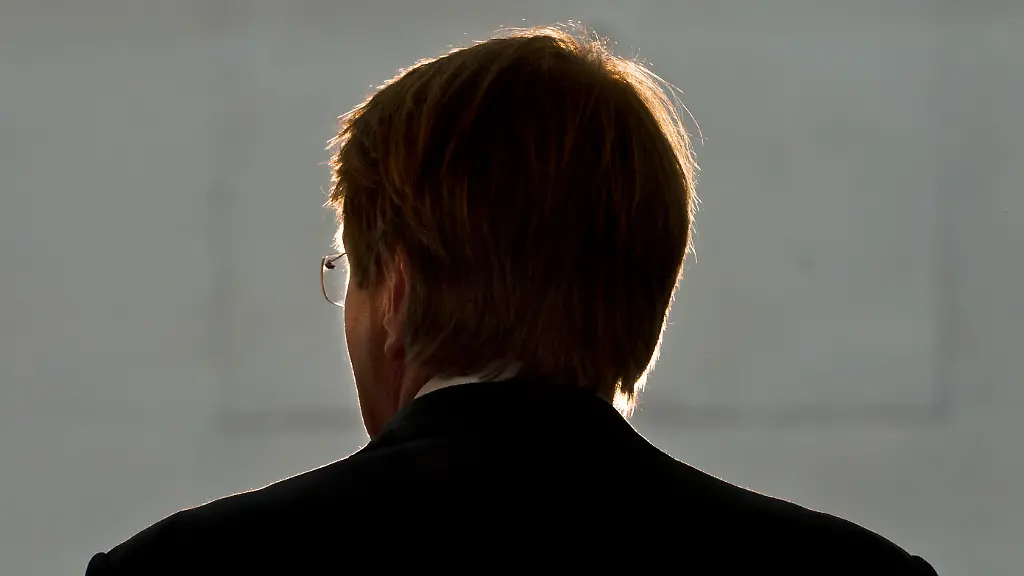
Kanzleramtsminister Pofalla hat vor dem Bundestag ausgesagt - und kurzerhand den NSA-Skandal für beendet erklärt. Zieht sich die Bundesregierung damit aus der Affäre? Noch lange nicht. Deutschlands Einwohner können sich weiter überwacht fühlen.
Ronald Pofallas Auftritt vor dem Parlamentarischen Kontrollgremium des Bundestages hat unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. Für die Union ist die Affäre vorbei, für die Opposition noch nicht. Wer hat recht?
Der Kanzleramtsminister stützte sich bei seinen Erklärungen vor allem auf zwei Aussagen. Erstens: Briten und Amerikaner hätten versichert, sich "auf deutschem Boden an deutsches Recht" zu halten. Zweitens: Bald gebe es ein "No-Spy-Abkommen" zwischen den USA und Deutschland.
"Deutsches Recht auf deutschem Boden"
Treuherzig versichern die angelsächsischen Bündnispartner, sie hielten sich an die deutschen Gesetze. In Deutschland. Es ist dieses wichtige Detail, das den Unterschied ausmacht. Denn den Dokumenten des Ex-Geheimdienstlers Edward Snowden zufolge bekommt die National Security Agency massenhaft Kommunikationsdaten vom britischen GHCQ zugeliefert. Der Nachrichtendienst kopiere den Internetverkehr an seiner transatlantischen Datenleitung. Dieser kann danach analysiert, indiziert und aufbereitet werden, auch in Echtzeit. Also potenziell alle Daten, die sich in Richtung USA bewegt und von dort kommen. Deutsches Recht und deutscher Boden sind dabei, auf gut Deutsch, schnurzpiepegal.
Die NSA agiert auf Basis des Foreign Intelligence Surveillance Act (Fisa) und der "Executive Order 12333". Zu der Regelung heißt es in einem Papier des Geheimdienstes: "Die Sammlung wird mit verschiedenen Instrumenten auf der ganzen Welt durchgeführt, größtenteils außerhalb der Vereinigten Staaten." Dies passt zu Snowdens Angaben, dass die GHCQ-Aktivitäten umfassender sind als die der NSA selbst.
Pofalla sagt, die NSA und das GHCQ führe "keine flächendeckende Datenauswertung deutscher Bürger" durch. Pofalla schlussfolgert aus dieser Aussage, dass die diskutierten Kommunikationsdaten nicht von NSA und GCHQ erhoben werden. Eine steile These des Kanzleramtsministers, denn auch hier gilt es genau zu lesen: Datenauswertung heißt nicht Datenerhebung oder -kopie. Wo beginnt die Auswertung? Wenn die E-Mail bereits nach Schlüsselwörtern durchsucht als verdächtig identifiziert ist und sich – logischerweise – erst dann ein NSA-Mitarbeiter den Fall genau ansieht? Auch hier ist deutsches Recht für die Geheimdienste völlig irrelevant. Die millionenfachen Menschenrechtsverletzungen sind damit keinesfalls widerlegt, wie Pofalla behauptet.
Unklar ist noch immer, was mit US-Unternehmen wie Google, Apple und Co. ist, die im Prism-Spionagenetzwerk mit der NSA zusammenarbeiten. Woher kommen die massenhaften Daten, die das Echtzeit-Überwachungsprogramm XKeyscore speisen? Pofalla wandelt mit seinen Behauptungen auf einem haardünnen Grat.
"No-Spy-Abkommen"
Die USA haben den Deutschen also ein "No-Spy-Abkommen" angeboten. Was dies genau beinhalten soll, ist unbekannt. Drei Hauptfelder wären möglich.
Erstens die Aktivitäten, mit denen sich die Vereinigten Staaten um "ökonomische Stabilität" sorgen und "Gefahren für die Finanzwirtschaft" abwehren wollen, wie der "Spiegel" aus Snowdens Papieren zitiert. Damit ginge es um Wirtschaftsspionage.
Zweitens könnte es die politische Dimension umfassen. So hatte Snowden enthüllt, dass die EU-Vertretung in New York sowie die Telefonanlage in Brüssel verwanzt seien. Sie sind möglicherweise Teil des XKeyscore-Netzwerkes. Deutsche Politiker und ihre vertraulichen Gespräche können so leicht ins Visier genommen werden.
Drittens - die mit Abstand unwahrscheinlichste Variante - könnte die NSA darauf verzichten, Daten von Deutschlands Einwohnern auszuwerten. Dann müsste der Geheimdienst jedoch sämtliche entsprechenden IP-Adressen grundsätzlich ignorieren. Das wird nicht passieren, wird Deutschland doch als lohnendes Spionageziel angesehen.
Unabhängig vom Inhalt ist ein "No-Spy-Abkommen", das zwischen BND-Präsident Gerhard Schindler und NSA-Chef Keith Alexander direkt besprochen wird, wie Pofalla versicherte, fragwürdig. Wenn es so etwas geben wird, sollte es auch juristisch in Form eines Abkommens legitimiert werden – und nicht durch die Geheimdienste selbst. Das birgt Gefahren, etwa von Nebenabreden.
Insgesamt sind vor allem Fragen, die direkt die Interessen und den Schutz deutscher Bürger betreffen, entweder noch nicht eindeutig oder gar nicht beantwortet. Das Ende der Spionageaffäre, die das Kanzleramt wenige Wochen vor der Bundestagswahl ausgerufen hat, ist noch lange nicht in Sicht.