Informant oder Denunziant? "Der Whistleblower ist eine ambivalente Figur"
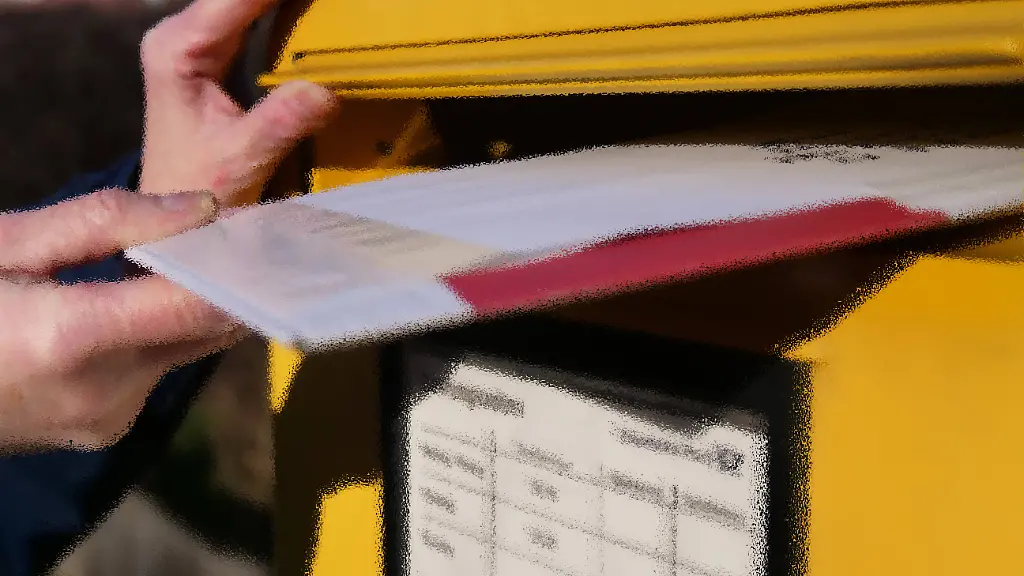
Seit den Enthüllungen etwa von Julian Assange, Edward Snowden und Chelsea Manning dürfte fast jeder den Begriff Whistleblower kennen. In Deutschland sind Menschen, die Missstände in Unternehmen und Behörden aufdecken, nun besser geschützt. Wie ist das zu bewerten?
Seit den Enthüllungen etwa von Julian Assange, Edward Snowden und Chelsea Manning dürfte fast jeder den Begriff Whistleblower kennen. In Deutschland sind Menschen, die Missstände in Unternehmen und Behörden aufdecken, nun besser geschützt. Wie ist das zu bewerten?
Klaus Ulrich Schmolke ist Professor für Wirtschaftsrecht an der Universität in Erlangen-Nürnberg. Zu den Auswirkungen der neuen EU-Whistleblower-Richtlinie und ihrer Umsetzung in Deutschland hat er intensiv geforscht und hält international Vorträge zum Thema.
Das Whistleblower-Gesetz ist nach anderthalb Jahren Streit hierzulande in Kraft getreten. Sind Whistleblower in Deutschland nun besser geschützt?
Klaus Ulrich Schmolke: Ja, dieses Gesetz verbessert die Situation von Hinweisgebern in Deutschland ganz erheblich. Allerdings fangen wir auch nicht bei null an. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat gelegentlich schon die deutschen Arbeitsgerichte zur Ordnung gerufen, wenn diese eine Kündigung des Whistleblowers durch den Arbeitgeber vorschnell als rechtens angesehen haben. Der EGMR sieht das Whistleblowing nämlich als Ausdruck der Meinungsäußerungsfreiheit an, deren Beschränkung verhältnismäßig sein muss.
Für den Whistleblower war damit aber ein oft langer, riskanter Kampf vor den Gerichten verbunden. Was ändert sich denn jetzt konkret?
Ein Whistleblower kann nun jeden Rechtsverstoß, der eine Straftat ist oder bestimmte Ordnungswidrigkeiten betrifft, melden. Hält er sich dabei an die Vorgaben des Hinweisgeberschutzgesetzes, genießt er einen ganz weitgehenden Schutz. Entdeckt er im Unternehmen beispielsweise Korruption, Geldwäsche oder Betrug, kann er das intern im Unternehmen oder extern gegenüber einer speziell dafür eingerichteten Meldestelle melden. Dafür müssen Firmen mit mindestens 250 Beschäftigten und Behörden ab sofort interne Kommunikationskanäle einrichten, über die potenzielle Whistleblower ihr Anliegen schildern können, Unternehmen ab 50 Beschäftigte müssen das ab Dezember. Zum Schutz des Hinweisgebers besteht insbesondere ein generelles Repressalienverbot. Wird hiergegen verstoßen, hat der Hinweisgeber einen speziellen Schadensersatzanspruch.
Große Whistleblowing-Fälle waren hierzulande Lux-Leaks oder Cum-Ex, Finanzskandale bei denen Unternehmen, oder vermögende Privatpersonen mit Hilfe von Wirtschaftsberatern ihre Steuern gegen Null gedrückt haben oder sogar Steuern vom Fiskus erstattet bekamen, die sie gar nicht gezahlt hatten. Luxemburg sieht darin bis heute keinen Gesetzesverstoß, bei Cum-Ex hat es Jahre gedauert, bis die deutsche Justiz darin einen Rechtsbruch gesehen hat. In diesen Fällen stünde also ein Whistleblower auch mit dem neuen Gesetz nicht besser da als zuvor?
Im Lux-Leaks-Fall ist am Ende der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte eingeschritten und hat entschieden, dass das Aufdecken der Steuervermeidungsstrategien im öffentlichen Interesse war und dem Whistleblower deshalb Schutz gebührt, auch wenn der Sachverhalt, also die Steueroptimierung selbst, nicht rechtswidrig und der Datendiebstahl selbst ein Rechtsverstoß war. Aber generell gilt: Mit dem Whistleblower-Gesetz wird niemand geschützt, der unethisches Verhalten aufdeckt, solange es sich nicht zugleich um einen Verstoß gegen geltendes Recht handelt. Das Gesetz begreift den Whistleblower als eine Art Hilfssheriff, der die öffentlichen Stellen dabei unterstützt, geltendes Recht durchzusetzen.
Aber im Lux-Leaks Fall gab es doch ein überragendes öffentliches Interesse. Es ging um Milliarden Steuereinnahmen, die Unternehmen nicht zahlten und die dadurch anderen Staaten für ihre öffentliche Aufgaben fehlten.
Das Interesse Luxemburgs und der betroffenen Unternehmen mag ein ganz anderes sein, nämlich, dass Angestellte sich an berufliche Verschwiegenheitspflichten halten und nicht die Ausnutzung gültiger Steuerregeln, die Ausdruck des luxemburgischen Geschäftsmodells sind, in der Presse anprangern. Wieso sollte die Empörung des Hinweisgebers über diese Steueroptimierungsmodelle Vorrang gegenüber den Interessen der anderen Seite haben? Es geht ja nie allein um die Interessen des Hinweisgebers, sondern immer auch um die Interessen der Unternehmen und Behörden, in deren Sphäre der gemeldete Verstoß stattgefunden haben soll. Hinzukommen die konkreten Personen, die für das gemeldete Verhalten verantwortlich sein sollen. In Bezug auf die Bewertung rechtmäßigen (!) Verhaltens befinden wir uns letztlich in der politischen Sphäre. Jedenfalls will das Whistleblower-Gesetz nicht die Äußerungen im politischen Meinungskampf schützen, sondern die Rechtsdurchsetzung verbessern.
Was ist, wenn der Hinweisgeber glaubt, dass der Missstand, den er entdeckt hat, gegen das Gesetz verstößt?
Nach dem neuen Hinweisgeberschutzgesetz genießt er bereits dann den Schutz des Gesetzes, wenn der Hinweisgeber hinreichenden Grund zu der Annahme hatte, dass seine Meldung einen Rechtsverstoß betrifft, der unter das Gesetz fällt.
Desiree Fixler war Nachhaltigkeitschefin der Fondgesellschaft DWS, hat der Deutschen Bank Greenwashing vorgeworfen und wurde daraufhin rausgeworfen, was nun Teil von gerichtlichen Auseinandersetzungen ist. Sie wirft Deutschland vor, seine Whistleblower viel schlechter zu schützen als etwa die USA. Während sie hierzulande als undankbar gelten, würden sie in den USA belohnt. Warum belohnen wir unsere Whistleblower nicht?
In Kontinentaleuropa herrscht zum einem die übergroße Angst vor missbräuchlichen Meldungen. Die Vorstellung ist, dass die Leute eine Lotteriementalität an den Tag legen, also einfach Meldungen in der Hoffnung streuen, irgendwann mit Glück eine Prämie zu ergattern. Außerdem ist in der alten Welt die Idee stark, dass ein Whistleblower aus hehren Motiven zu handeln habe. Bekäme er jetzt eine Belohnung, dann diskreditiert ihn das als "Söldner". Die US-Amerikaner sind in dieser Hinsicht viel pragmatischer. Die sagen einfach, wenn uns irgendein privater Spieler bei der Rechtsdurchsetzung helfen kann, dann ist die Möglichkeit hiermit Geld zu verdienen, einfach ein starker Anreiz. Dort gibt es denn auch vielfach Regelungen zur finanziellen Belohnung von Hinweisgebern, etwa indem der Whistleblower einfach einen Teil des gegen den gemeldeten Missetäter verhängten Bußgeldes als Prämie erhält. Wir haben in Europa da tatsächlich ein Mentalitätsproblem - wir möchten profitorientierte Spieler nicht zur Rechtsdurchsetzung einsetzen.
Spielen die Motive des Whistleblowers denn im neuen Gesetz überhaupt eine Rolle?
Nein, die Motive des Hinweisgebers sind völlig egal. Das gibt die EU-Whistleblower-Richtlinie vor. Ein ehemaliger Mitarbeiter auf dem Kriegspfad wird daher genauso geschützt wie derjenige, der sagt, das ist schlimm, das schädigt die Allgemeinheit, da müssen wir was tun. Der EU-Gesetzgeber hat hier richtig erkannt, dass das Motiv des Hinweisgebers für seinen Wert für die Rechtsdurchsetzung unerheblich ist. Damit sind wir eigentlich schon die Hälfte des Weges gegangen …
… und sollten dann auch Prämien einführen?
Ich fände das sehr sinnvoll. Denn der Hinweisgeber geht trotz des neuen Hinweisgeberschutzgesetzes immer noch ein hohes Risiko ein. Er bekommt allenfalls die Schäden ersetzt, die ihm durch Repressalien wie den Verlust des Arbeitsplatzes und anschließende Gerichtsprozesse entstehen, und das auch nur, wenn alles gut geht und die Gerichte ihm ganz am Ende recht geben. Im besten Falle steht er da am Ende bei null, im schlechtesten Falle hat er hohe Kosten. Und deshalb ist es wichtig und richtig, einen starken finanziellen Anreiz für Hinweisgeber zu setzen. Selbst so ein Fall wie Wirecard zeigt, dass finanzielle Anreize eine entscheidende Rolle spielen können, Missstände aufzudecken. Dort handelte kein Whistleblower, sondern ein Leerverkäufer, der sich seine Prämie selbst über den Börsenhandel verdient hat. Aber bisher lehnt die große Mehrheit der Deutschen finanzielle Anreize für Hinweisgeber ab, weil sie keine sogenannten "amerikanischen Verhältnisse" wollen.
Warum tut sich unsere Gesellschaft so schwer damit, Whistleblower anzuerkennen und zu schützen?
Der Whistleblower ist eine ambivalente Figur. Gerade in Kontinentaleuropa wurde er lange als der Informant, der Denunziant, der Spitzel wahrgenommen. Die Abwehrhaltung in Deutschland beruht auf historischen Erfahrungen aus der Nazizeit oder der DDR, als die Stasi Regimekritiker überwachte und IMs sie verpfiffen. Erst in jüngerer Zeit hat sich das öffentliche Ansehen der Hinweisgeber verbessert, was auch mit der intensiven Lobbyarbeit der Whistleblower-Organisationen zu tun hat.
Viele Unternehmen hadern mit dem neuen Gesetz. Herr Schmolke, Sie sprechen hier selbst von einem "Clash of Cultures" zwischen Unternehmensrecht und der Whistleblower-Recht. Was genau meinen Sie damit?
Über die Autorin
Das neue Gesetz stellt dem Whistleblower frei, den Missstand intern bei einer Meldestelle im Unternehmen oder aber extern bei einer dafür vorgesehenen öffentlichen Meldestelle anzuzeigen. Das war im Gesetzgebungsverfahren hart umkämpft, die Wirtschaft hatte sich massiv dagegen gesträubt. Denn die Unternehmen betreiben zu Recht mit viel Aufwand eine interne Compliance-Organisation, um solche Missstände frühzeitig zu entdecken und innerhalb des Unternehmens abzustellen, bevor sie nach außen dringen und in den Medien landen. Die Befürchtung der Unternehmen ist nun, dass all diese Compliance Maßnahmen inklusive der nun verpflichtenden Whistleblower-Meldestelle am Ende hohe Kosten produzieren, aber ihnen wenig Nutzen bringen, wenn und weil sich der Hinweisgeber im Zweifel lieber an eine externe Meldestelle wendet, weil ihm das sicherer ist.
Aber haben sich das die Unternehmen nicht selbst zuzuschreiben?
Ich würde jedem Unternehmen raten, nun zu versuchen, seine internen Meldewege so attraktiv wie nur möglich zu gestalten. Das heißt: Die Missstände ernstnehmen, sie abstellen und nicht unter den Teppich kehren, so dass potenzielle Whistleblower künftig darauf vertrauen können, dass ihre internen Hinweise nicht vergebens sind.
Häufig wenden sich Whistleblower aber auch gleich an die Medien.
Das ist für das Unternehmen und die betroffenen Personen die höchste Eskalationsstufe. Das Hinweisgeberschutzgesetz knüpft den Schutz solcher Offenlegungen an enge Voraussetzungen. Das Gesetz nennt hier etwa den Fall, dass andernfalls - also bei zunächst interner oder externer Meldung - irreversible Schäden drohen, oder wenn der Hinweisgeber annehmen muss, dass Missetäter, Unternehmen und Behörden Absprachen getroffen haben. Praktisch am bedeutsamsten dürfte aber der Fall werden, dass nach entsprechender Meldung die externe Meldestelle über mehrere Monate untätig bleibt oder keine Rückmeldung gibt. Dann darf sich der Hinweisgeber auch an die Öffentlichkeit wenden und erhält den Schutz des Gesetzes.
Was ist mit den Whistleblowern, die selbst an den Missetaten beteiligt oder irgendwie verstrickt sind?
Gegen eine Ahndung des von ihnen begangenen und später gemeldeten Rechtsverstoßes werden Hinweisgeber durch das neue Gesetz nicht geschützt. Allerdings könnten Unternehmen die Option für die interne Meldung attraktiver machen, indem sie eine Art Kronzeugenregelung anbieten, also etwa eine Absicherung, die dem Beschäftigten den Arbeitsplatz garantiert, wenn er dazu beiträgt, dass der Missstand aufgedeckt und behoben wird, vorausgesetzt er ist keine Zentralfigur des gemeldeten Verhaltens.
Im öffentlichen Dienst sei der Whistleblower-Schutz "weitgehend ausgehöhlt", so Kritiker, da als Verschlusssache deklarierte Dokumente nicht verwertet werden könnten. Ein Edward Snowden wäre demnach auch in Deutschland nicht geschützt. Teilen Sie diese Kritik?
Das ist in der Tat eine massive Einschränkung für den öffentlichen Bereich. Von Kollegen, die sich im öffentlichen Recht auskennen, höre ich, dass der in der Praxis zu beobachtende inflationäre Gebrauch der Verschlusssachekategorie "VS-Nur für den Dienstgebrauch" den Hinweisgeberschutz substantiell entwerte. Immerhin gilt die Ausnahme für Verschlusssachen dieser Kategorie nicht, wenn es sich um die interne Meldung einer Straftat handelt.
Mit Klaus Ulrich Schmolke sprach Monika Dunkel