Ohne WLAN im DigitalzeitalterDeutsche Schulen verschlafen den Wandel
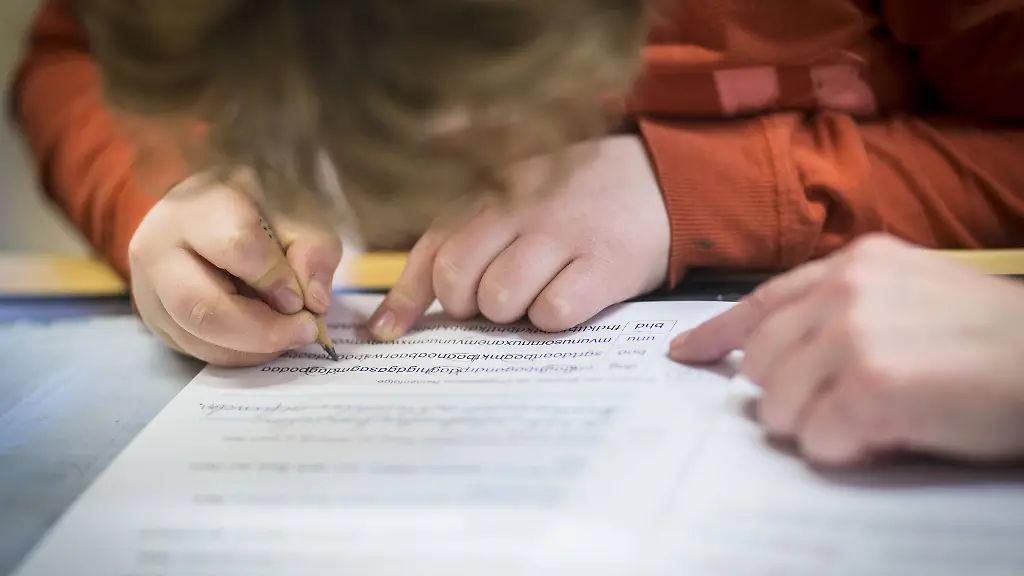
Die Qualität der Bildung sinkt - wieder mal. 18 Jahre nach dem Pisa-Schock schneiden deutsche Schüler in Deutsch und Mathe erneut schlechter ab, die Schulabbrecherquote steigt, Tausende Lehrer fehlen. Und nun tut sich eine weitere Baustelle auf.
Eine absehbare Katastrophe? Nein, so weit will Axel Plünnecke nicht gehen. Grund zur Sorge sieht der Bildungsforscher aber trotzdem. Denn an deutschen Schulen droht laut diesjährigem INSM-Bildungsmonitor ein Reformstau - und das, obwohl mit der Flüchtlingsintegration und dem digitalen Wandel in den nächsten Jahren reichlich zusätzliche Arbeit auf die Pädagogen zukommt. Im Vergleich zum Vorjahr schneiden laut Studie fast alle Bundesländer schlechter ab - vor allem bei Schulqualität, Integration und der Bekämpfung der Bildungsarmut gibt es Defizite. Die Ausnahme ist neben Schleswig-Holstein ausgerechnet Berlin, dessen Bildungssystem im Ländervergleich bis dato zehn Jahre in Folge das Schlusslicht bildete. Jetzt rangiert die Hauptstadt auf Platz 13. Wenigstens eine gute Nachricht.
Der Blick auf den Bundesdurchschnitt gibt weniger Anlass zur Freude: In den Kernfächern Deutsch und Mathe schneiden deutsche Schüler wieder schlechter ab als in den Vorjahren. 18 Jahre nach dem Pisa-Schock lasse sich "eine gewisse Stagnation" in Sachen Bildungsqualität beobachten, heißt es in der Studie. Parallel verlassen immer mehr Jugendliche ohne Abschluss die Schule. Im Zuge der Flüchtlingskrise sei die Zahl der Schulabbrecher vor allem unter Ausländern gestiegen - konkret von 11,8 Prozent im Jahr 2015 auf 14,2 Prozent im Folgejahr. "Wir brauchen einen neuen Bildungsaufbruch", fordert INSM-Geschäftsführer Hubertus Pellengahr. Das notwendige Geld dafür sei zwar da, aber es werde an den falschen Stellen eingesetzt - Beispiel Rentenerhöhung. Die Steuermilliarden des Bundes, sagt er, wären besser an den Schulen aufgehoben als bei den Rentnern.
Ratschläge an die Politik hat nicht nur Pellengahr parat. Die Studienautoren vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) präsentieren eine ganze Reformagenda - inklusive eines zusätzlichen Investitionsbedarfs von über elf Milliarden Euro. Vor allem in Ländern mit hohem Migrantenanteil müsse mehr Geld für die Integration in die Hand genommen werden, ergänzt Studienleiter Plünnecke. Rheinland-Pfalz könnte dafür als Vorbild dienen. Laut Studie wirkt sich dort die "soziale Herkunft der Kinder nur gering auf den Bildungserfolg aus" - entsprechend hoch sind demnach die Chancen auf Teilhabe auch für Kinder aus bildungsschwachen Familien. Ein großes Plus sei, dass Fremdsprachen schon in der Grundschule unterrichtet werden. Und auch die Erfolgsquote an den Berufsfachschulen heben die Studienautoren hervor.
Daddeln ja, aber mit Mehrwert
Trotzdem schafft es Rheinland-Pfalz im Vergleich nur auf Platz 9, während Sachsen den Spitzenplatz einnimmt. Vor allem bei der Betreuung in Ganztagsschulen und Kitas liege das ostdeutsche Bundesland vorn. Thüringen und Bayern attestieren die Studienautoren ebenfalls ein relativ leistungsfähiges Schulsystem - wenn auch mit Defiziten. So mangele es in Bayern nach wie vor an ausreichend Ganztagsschulen. In Thüringen fehle es hingegen an jungen Lehrkräften - und auch die Schulabbrecherquote bei ausländischen Jugendlichen sei zu hoch. Viele dieser Baustellen existieren schon seit Jahren. Und angesichts des Lehr- und Fachkräftemangels werden einige Lücken kaum zu schließen sein. Umso kritischer sehen die Studienautoren, dass die Schulen auf absehbare Probleme kaum vorbereitet sind.
Gemeint ist nicht nur das Thema Migration. Auch der digitale Fortschritt mag zwar deutlich für jedermann sichtbar sein, deutsche Schulen jedoch gleichen dem Bildungsmonitor zufolge nicht selten weißen Flecken in Sachen Digitalisierung. Allein bei der Frage, wie gut die IT-Ausstattung jeweils ist, herrscht Datenflaute. Die Studienautoren müssen sich deshalb auf Untersuchungen der Telekom vom vergangenen Jahr stützen - oder auf Befragungen der Schulen. Die aktuellste Umfrage stammt aus dem Jahr 2016. Nur jede dritte befragte Berufsschule gab darin an, über einen ausreichenden WLAN-Zugang zu verfügen. In 40 Prozent der Schulen fehlte er komplett.
Geld ausgeben, aber an richtiger Stelle
Entsprechend weit entfernt sind die Schulen laut Studie vom vielbeschworenen "digitalen Unterricht" - geschweige denn passenden Lehrkonzepten. Denn auch bei Fortbildungen für Lehrkräfte hinkt Deutschland im internationalen Vergleich hinterher. Nur etwa die Hälfte der Pädagogen gibt an, schon eine schulinterne oder externe IT-Weiterbildung gemacht zu haben. Die Selbstbenotung auf dem Gebiet Digitalisierung fällt entsprechend vorsichtig aus: Im Umgang mit Computern verfügt jede dritte Lehrkraft nach eigenen Angaben lediglich über Basiswissen.
Dass der Bund mit dem Digitalpakt rund fünf Milliarden Euro für eine bessere Ausstattung an den Schulen zugesichert hat, sei zwar ein "guter erster Schritt". Aber es komme eben "nicht nur auf die Infrastruktur, sondern auch auf pädagogische Konzepte und Kompetenzen" an, sagt Plünnecke. Ob die vorhandenen Mittel an der einen oder der anderen Stelle richtig eingesetzt sind, ist allerdings auch eine Ideologiefrage. Wo es Schwierigkeiten gibt, den Schülern allein schon die notwendigen Lese- und Sprachkompetenzen zu vermitteln, wird die Ausstattung mit Tablets im Unterricht kaum Priorität haben. "Die Schulqualität zu sichern, das ist die Pflicht", sagt Plünnecke. "Bei der Digitalisierung voranzukommen, die Kür."