Milliarden versenktWieso beerdigt Apple seine Autopläne?
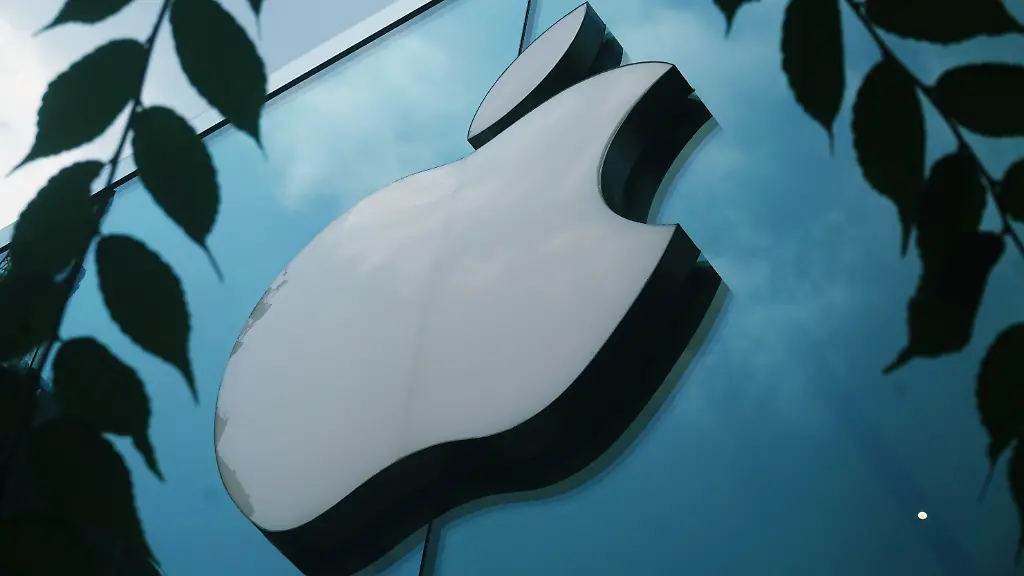
Nach mehr als zehn Jahren und Milliarden an Investitionen zieht Apple bei der Entwicklung autonomer Elektrofahrzeuge den Stecker. Einfluss auf die etablierte Autoindustrie hat der kalifornische Konzern trotzdem.
Wenn Apple sich in ein neues Geschäftsfeld wagt, wird das als eine Art Ritterschlag wahrgenommen. Als Signal: Hier ist wirklich Geld zu verdienen. Aber auch als Warnung an die etablierten Anbieter in diesem Geschäftsfeld: Ihr müsst Euch warm anziehen, denn Apple kommt und fegt euch weg wie sie einst Nokia weggefegt haben.
Was aber bedeutet es in diesem Zusammenhang, wenn der kalifornische iPhone-Konzern sich aus einem Geschäftsfeld wieder zurückzieht? Am Mittwoch wurde bekannt, dass Apple die Arbeit an seinem Autoprojekt beendet. Die Milliardeninvestitionen, die das Unternehmen seit über zehn Jahren in Pläne für ein autonom fahrendes und elektrisch angetriebenes Fahrzeug gesteckt hat, werden wahrscheinlich großteils abgeschrieben. Hunderte Mitarbeiter, die an dem "Project Titan" von Apple gearbeitet haben, müssen sich neu orientieren: Ein Teil von ihnen soll Berichten zufolge in Apples Einheit für generative Künstliche Intelligenz wechseln. Weitere werden demnach entlassen.
Das Apple-Autoprojekt stand vor allem im Kontext der Euphorie für das autonome Fahren. In den Anfangsjahren von Project Titan wurde in Kalifornien viel über eine Art rollendes Wohnzimmer geredet, das Apple plane - ohne Lenkrad, Fahr- und Bremspedal. Zahlreiche Dienstleister wie Uber und Lyft, Tech-Konzerne wie Google mit der Tochter Waymo, aber auch angestammte Autofirmen wie GM mit der Tochter Cruise oder BMW und Mercedes mit ihrer damaligen Tochter FreeNow wurden von dieser Euphorie getragen.
Roboterautos, so damals die Erwartung, würden bis spätestens Ende des Jahrzehnts die Mobilität völlig verändern und das würde zu völlig neuen Geschäftsmodellen führen. Doch bei dieser Roboterisierung des Fahrens macht sich seit einigen Jahren Ernüchterung breit. Ein weithin beachtetes Warnzeichen war der tödliche Unfall eines autonom fahrenden Cruise-Taxis in San Francisco im vergangenen Herbst, der dazu führte, dass die kalifornischen Behörden ihre Erlaubnis für völlig autonome Fahrversuche zurückzogen. Die technischen Hürden haben sich als viel größer erwiesen, weswegen auch Apple irgendwann wieder mit Lenkrad und Bremse plante. Die Ernüchterung dürfte nun der Hauptgrund für Apples Rückzug sein.
Tesla wird weniger profitabel
Manch einer könnte nun unken, dass Apples Rückzug auch ein Zeichen ist, dass die Hoffnungen im Zusammenhang mit der Elektrifizierung des Fahrens ebenfalls zu rosig waren Schließlich wurde auch hier die Mobilitätsbranche lange von der Erwartung angetrieben, dass sich im Zuge der Elektrifizierung neue, einträgliche Geschäftsmodelle etablieren lassen: Carsharing, Autoabos, Fahrdienste. Nicht mehr Fahrzeuglieferanten würden die Szene dominieren, sondern Mobilitätsdienstleister, die mithilfe ihrer Kundendaten immer neue Dienste erfänden.
Das könnten aus Sicht eines Tech-Konzerns wie Apple interessante - und lukrative - Geschäfte sein. Doch bislang verläuft die Entwicklung konservativer als vorhergesagt: Der Antrieb ändert sich (langsam), nicht aber so sehr die grundlegenden Muster von Autoeigentum, -handel, -wartung. Das heißt nicht, dass elektrisches Fahren auf lange Sicht kein auskömmliches Geschäft wird, selbst wenn es derzeit auf manchen Märkten Rückschläge gibt. Aber damit wird das potenzielle Renditeversprechen kleiner.
Man kann es gut an Tesla sehen: Der US-Elektroautopionier hat seine Vorhersagen erfüllt und ist inzwischen in den Kreis der dominierenden globalen Autohersteller vorgedrungen. Aber er hat sich ihnen auch in Sachen Profitabilität angeglichen: Im vierten Quartal schrumpfte Teslas operative Marge auf 8,2 Prozent: Das ist nicht mehr das Level anderer Tech-Unternehmen -unter denen sich Tesla immer noch gerne bewertet sieht - sondern das Niveau von traditionellen Autobauern.
Selbst wenn die rund 8 Prozent eine Momentaufnahme bleiben sollten: Die Margen sind auch durch den Preiskampf der zahlreichen chinesischen Elektroautobauer unter Druck geraten. Man kann heute sagen, dass die Innovation im Autogeschäft (und damit auch der Veränderungsdruck auf die etablierten Player) nicht mehr in erster Linie von kalifornischen Tech-Anbietern kommt (Tesla hier nicht mitgezählt), sondern von chinesischen Newcomern.
Der Preis- und Innovationsdruck geht dazu maßgeblich von der Batterietechnik aus, einem Feld, auf dem Apple kaum sichtbare Kompetenzen aufbauen konnte. Die Erwartungen von Apple in Sachen Profitabilität sind ohnehin ganz andere: Aus dem Geschäft mit Smartphones, Rechnern und Dienstleistungen ist der Apfelkonzern hohe zweistellige Margen gewohnt, häufig um 30 Prozent. Das mit Autos zu erreichen, wird selbst bei Traumwagen schwierig, Ferrari schreibt ungefähr 24 Prozent.
Autos sammeln Daten
Das wichtigste Feld auf dem sich Apple Hoffnungen gemacht haben dürfte, im Mobilitätsgeschäft mitzumischen, ist das vernetzte Auto. Das Fahrzeug als Datensammler und Knotenpunkt von Ortungs-, Unterhaltungs-, Dienstleistungs-, und Konsumangeboten hat nicht nur Google, sondern eben auch Apple ins Autogeschäft getrieben. Wer das "Gehirn" des fahrenden Computers beherrscht, was das Auto bald ist, der kann die besten Geschäfte machen, so das Kalkül.
Diese Rechnung gilt nach wie vor. Nur braucht eben Apple, um dieses Geschäft machen zu können, keine eigene Hardware zu entwickeln. Längst haben die meisten Autobauer weitreichende Verträge mit Google und/oder Apple geschlossen. Viele lassen sich zentrale Softwarefunktionen von den Tech-Konzernen liefern. Apple CarPlay und Googles Gegenstück Android Auto gehören fast zum Standard in den heutigen Autos - damit haben die Tech-Konzerne zumindest teilweise Zugriff auf die Kundenbeziehungen und Mobilitätsdaten der Autonutzer. Der Ehrgeiz von Autobauern wie Volkswagen und Mercedes, die ursprünglich angekündigt haben, die Software ihrer Fahrzeuge in Zukunft vollständig selbst beherrschen zu wollen, ist längst merkbar schwächer geworden.
Was bedeutet somit Apples Rückzug für die traditionellen (deutschen) Autobauer? Nicht so viel. Die Pläne von Apple oder US-amerikanischen Tech-Newcomern in der Autowelt (außer Tesla) sind längst nicht mehr die Dinge, die ihnen die größten Kopfschmerzen bereiten müssen. Die großen Herausforderungen für sie kommen von Tesla, chinesischen E-Autobauern, asiatischen Batterieherstellern und Spezialchipproduzenten. Über Apples Autoprojekt hingegen war so gesehen schon die Zeit hinweggegangen.