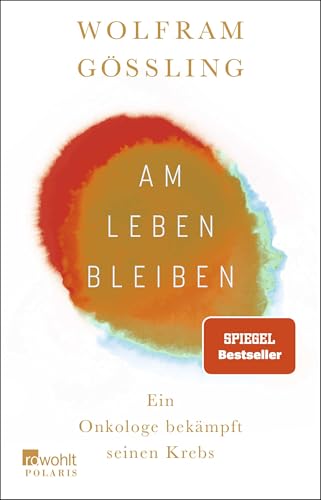Von der Theorie zur RealitätWenn ein Onkologe selbst zum Patienten wird
 Von Larena Klöckner
Von Larena Klöckner
Wolfram Gössling begleitet Menschen mit Krebs durch die schwere Zeit ihrer Erkrankung. Bis der Onkologe selbst einen besonders tödlichen Krebs bekommt. Wie verändert die Diagnose die Arbeit und das Leben des Arztes? Einblicke in eine Doppelrolle.
Ein Piepton, der alles verändert. Für Wolfram Gössling wird das an einem Dienstagmorgen im Februar 2013 Realität. Der renommierte Onkologe steht vor seinen Studierenden im Vorlesungssaal in Harvard. Er erklärt gerade, wie man mit Patienten und Patientinnen spricht, Anamnesen erhebt und ihnen eine Diagnose übermittelt. Bis es piept. "Ruf mich sofort an, es ist dringend", steht auf dem Gerät, das Gössling stets bei sich trägt: für Notfälle auf seiner Arbeit. Doch diesmal kommt die Nachricht nicht aus dem Krankenhaus, sondern von seinem Hautarzt.
"In dem Moment war mir sofort klar, jetzt ändert sich etwas", erinnert sich Gössling im Gespräch mit ntv.de. Eine Woche zuvor hatte der damals 45-Jährige eine Gewebeprobe entnehmen lassen. Von einem Pickel auf seinem rechten Wangenknochen. Vier Monate lang war er schon da gewesen - Sorgen hatte sich der Experte bis dahin keine gemacht. Das Telefonat auf dem Flur der amerikanischen Eliteuniversität verläuft kurz. "Du hast ein Angiosarkom. Es tut mir leid, dass ich dir das sagen muss", sagt sein Hautarzt, bevor er selbst anfängt zu weinen.
Angiosarkom - das sagt dem erfahrenen Onkologen zu diesem Zeitpunkt nichts. "Ich hatte in meiner ganzen Laufbahn nie einen Patienten mit Angiosarkom behandelt. Das ist eine extrem seltene Krebsart, nur einer von zehntausend Krebspatientinnen und -patienten ist davon betroffen", erklärt er im Nachhinein. Überlebenswahrscheinlichkeit: vier Prozent.
"Ich habe versucht, an das zu denken, was mir während meiner Ausbildung gesagt wurde: Wir sind keine Statistik, sondern einzelne Individuen. Und da zählt nur null oder 100 Prozent. Entweder man überlebt oder überlebt nicht", sagt Gössling. Statistiken und Zahlen seien für Ärzt*innen natürlich wichtig. Um Chancen einzuschätzen, Behandlungen zu planen. Aber nicht für Patient*innen. "Ich kann nicht zu 96 Prozent leben. Es geht nur ganz oder gar nicht."
Im freien Fall
Ganz oder gar nicht - diese Frage kann Gössling zunächst nicht beantworten. Er kann nur versuchen, Kontrolle in einer unkontrollierbaren Situation zu übernehmen. "Es fühlte sich an, als wäre man schon im freien Fall, aber merkt es noch gar nicht richtig", so Gössling. Doch statt zu fallen, geht er zurück in den Hörsaal, um die Vorlesung zu beenden.
Durch die Folien klicken, erklären, unterrichten. "Es war das einzig Bekannte in dem Moment. Das Einzige, wo ich noch dachte, ich habe Kontrolle. Ich war im Fall und wusste nicht, was los ist mit mir. Zurück in den Hörsaal zu gehen und mich an jeden bereits definierten Schritt zu halten, das schaffte ich noch", erinnert sich Gössling.
Als Arzt ist Gössling gut vernetzt. Er kennt Kolleginnen und Kollegen, die sich bestens auskennen, mit ihm zusammenarbeiten. Nur zwei Stunden nach der Diagnose sitzt Gössling im Krebszentrum. Gemeinsam mit seiner Frau. Auch wenn Gössling in seiner Funktion als Arzt stets darüber nachdenkt, wie man eine solche lebensverändernde Nachricht übermittelt, bleibt bei ihm selbst keine Zeit dafür. "Ich konnte mich nicht darauf vorbereiten, wie ich es meiner Frau sage", sagt er.
Das internationale Renommee als Experte auf dem Gebiet der Onkologie. All das Wissen und die Expertise, all die Menschen, die man über Jahre begleitet. Dinge, die kaum mehr nützen, wenn man selbst zum Patienten wird. "Ich war wie die meisten meiner Patienten komplett orientierungslos und wirklich haltlos", sagt Gössling. Wie er erklärt, sei für Krebspatienten nicht nur die Diagnose an sich, sondern auch all die Termine, das Warten und die Ungewissheit besonders belastend. Zu verstehen, was da eigentlich im Körper passiert und welche Behandlungsschritte die nächsten sind, stelle Betroffene vor eine riesige Herausforderung. Und das selbst dann, wenn man auf dem Gebiet Experten ist, wie Gössling selbst erfahren muss.
Wenn all das Wissen nicht mehr hilft
Nach einer zweistündigen Besprechung mit seinem ärztlichen Team ist Gössling am Boden zerstört. Zwei Stunden lang musste er sich nun also anhören, dass und wie er sterben wird. Das denkt er zumindest. Denn eigentlich waren es zwei produktive Stunden, in denen die weiteren Behandlungspläne im Detail besprochen wurden. Doch es braucht erst Gösslings Frau, um das zu verstehen, zu verarbeiten. Er selbst hat aus dem Gespräch kaum Informationen aufnehmen können, konnte nicht selektieren.
Die Ungewissheit und die Angst nehmen großen Einfluss auf die Psyche. "Es ist unabhängig vom Fachwissen oder wie weit man sich in die Materie eingearbeitet und eingelesen hat. In dem Moment ist man so gestresst als Patient, dass man die Fakten einfach so nicht verarbeiten kann", erklärt Gössling. Umso wichtiger sei es, dass sich die Ärzte und Ärztinnen Zeit für ihre Patienten nehmen. Zeit, die im alltäglichen Krankenhausbetrieb oft fehlt. Und das, obwohl sie so wichtig wäre, um Missverständnisse zu vermeiden und die Erkrankten an die Hand zu nehmen, findet Gössling.
Er selbst weiß, dass er in einer sehr privilegierten Position war. Schnelle Termine, Personen, die er zu jeder Zeit ansprechen kann. "Ich weiß, medizinisch ist es nicht unbedingt notwendig, dass man drei Stunden oder vier Stunden nach der Diagnose den nächsten Termin hat. Aber für den Patienten und auch die emotionale Stärke, die man braucht, um durch solche Therapie durchzukommen, kann es natürlich unglaublich viel bedeuten."
Denn die Erkrankung verlangt einem viel ab. Gössling erfährt in der Zeit einen starken Rückhalt durch Freunde und Familie. Er entscheidet sich dafür, ganz offen mit seiner Krankheit umzugehen. Sie nicht zu verheimlichen. Seine vier - zum Zeitpunkt der ersten Diagnose - sehr jungen Kinder erfahren zwei Tage nach dem Anruf, wie es um ihren Vater steht. "Papa ist krank, er braucht eine Behandlung. Und Papa wird anders aussehen, das wird anstrengend", rekonstruiert Gössling die Worte seiner Frau. "Meine Älteste hat damals gefragt, ob Papa sterben muss. Und wir sagten ihr, dass wir alles versuchen, damit das nicht passiert."
Buchstäblicher Gesichtsverlust
Alles versuchen. Dieser Plan stellt sich als langer und herausfordernder Weg dar. Auf die Diagnose im Februar 2013 folgen vier Monate Chemotherapie. Dann die Krebsoperation der rechten Gesichtshälfte. "Der Tumor hatte sich ungefähr drei Zentimeter unter der Haut schon ausgebreitet. Das hat dazu geführt, dass im Prinzip vom rechten Nasenflügel bis zum Ohr, vom unteren Augenlid bis zur Oberlippe, alles weggenommen wurde", sagt Gössling und fährt sich mit der Hand über die rechte Gesichtshälfte.
Die Operation bedeutet eine komplette Veränderung seines Aussehens. "Ich hatte Angst, diesen Anblick nicht ertragen zu können", erinnert sich Gössling. "Wie kann ich meinen Studierenden wieder gegenüberstehen, wenn ich ganz anders aussehe, anders bin, anders funktioniere?" All diese Gedanken verfolgen ihn. Bis zur Erkrankung war das Aussehen nie etwas, das den Onkologen groß interessierte. Es war einfach da. Aber die Vorstellung, dass seine eigenen Kinder ihn nicht mehr erkennen könnten, sich sogar vor ihm erschrecken könnten, löst Panik aus.
"Als ich aus dem Krankenhaus kam, völlig verquollen, mit Nähten drin und wirklich furchtbar aussah, kam meine Jüngste auf mich zu und sagte: Papa, du siehst komisch aus, aber ich habe dich trotzdem lieb", erzählt er. Auch wenn die Erleichterung über die Reaktion seiner Kinder groß ist, scheint die größte Hürde nicht genommen: sich selbst zu akzeptieren. Gössling versucht, seinen Anblick zu vermeiden. Seine Frau verdeckt die Spiegel in der Wohnung. Als nach einigen Tagen zum ersten Mal ein Tuch verrutscht, sieht Gössling ganz unvorbereitet in sein neues Spiegelbild. "Da sah mich ein Unbekannter an, der Schock war groß", erinnert er sich. Es dauerte mehrere Wochen, bis Gössling sich bereit fühlte, erneut einen Blick in den Spiegel zu werfen. Einkaufen ging nur mit Kapuzenpullover und gesenkten Blick.
Den dunkelsten Moment, so beschreibt es Gössling selbst, durchlebt er zehn Tage nach der schweren Operation. Bei der Kontrolluntersuchung wird ihm gesagt, dass die Operation nicht so erfolgreich war wie erhofft. Noch immer befinden sich Krebszellen in den Wundrändern. "Ich bin da durchgegangen, durch die Chemotherapie, durch diese aggressive Operation. Und das hatte sich alles nicht gelohnt." Sein ärztliches Team entscheidet, die restlichen Krebszellen mit einer Strahlentherapie zu bekämpfen. Es ist der einzige kleine Lichtblick, den Gössling sieht. "Ich habe mich allein gefühlt, kalt gefühlt. Ich wusste nicht, wie es weitergeht", erinnert er sich.
Krebspatient als Fulltime-Job
Es geht weiter. Gössling ist seit seiner Erkrankung Krebspatient. Und Arzt. Einmal wird er gefragt, welcher Arzt er gewesen sei. In der Vergangenheitsform. "In dem Moment war ich nicht nur verletzt, sondern auch wütend." Krebspatient zu sein, beschreibt Gössling als einen Fulltime-Job. Doch durch eine Diagnose ist man nicht plötzlich nur noch Patient. Man bleibe all das, was man sein Leben lang schon gewesen sei. Und das ist wichtig. Denn die Krebserkrankung führt bei vielen zu Problemen im Selbstwert. Alles Vertraute, alles Gewohnte, fällt plötzlich weg. Der Beruf, der einem Struktur gibt. Die Unternehmungen im Freundeskreis. Hobbys, denen man nachgehen möchte.
Als Arzt und Dozierender hat Gössling aus dieser Erfahrung eine ganz entscheidende Erkenntnis gewonnen. In Gesprächen mit Erkrankten sollte nach dem Leben, dem Beruf, den Interessen niemals so gefragt werden, als seien es Dinge aus der Vergangenheit. Denn Normalität ist etwas, das Halt geben kann.
Doch auch darüber hinaus verändert die Krankheit die Art und Weise, wie Gössling sich als Arzt sieht. "Ich glaube nicht, dass ich jetzt ein besserer Arzt bin. Sondern dass es anders ist", sagt er. "Es ist die Möglichkeit, die am eigenen Leibe erlebte, geteilte Erfahrung gemacht zu haben." Denn diese geteilte Erfahrung ermöglicht es dem Onkologen, seinen Patientinnen und Patienten mehr auf Augenhöhe zu begegnen. "Ich kann ihnen sagen, dass ich weiß, wie es ist, durch eine Chemotherapie zu gehen. Ich weiß, wie es ist, auf ein Untersuchungsergebnis zu warten und Angst zu haben."
Doch die Arbeit als Arzt ist intensiv. Zurück im Beruf dauert es, bis Gössling sich wieder bereit fühlt, mit Krebserkrankten zu arbeiten. Denn die Angst vor dem eigenen Sterben ist noch zu präsent. Er fühlt sich nicht in der Lage, als Arzt über Sterbebegleitungen, Hospize und den Tod zu sprechen. Das zu erkennen und sich bewusst zurückzuziehen, war sehr wichtig. Knapp zwei Jahre später ändern sich Gösslings Gefühle. Er möchte wieder Menschen durch ihre schwere Zeit helfen. Schließlich sei das der Grund gewesen, weshalb er Arzt geworden sei.
Die Brutalität der Therapie
Und dann ist im November 2020 der Krebs zurück. Wieder ein Angiosarkom, diesmal auf der linken Gesichtshälfte. Wieder steht Gössling vor einer schweren Behandlung. Diesmal ist er Teil einer klinischen Studie, in der Chemotherapie mit Immuntherapie kombiniert wird. Es folgt eine erneute Operation im Gesicht. Die eine positive Nachricht bringt: Die Immuntherapie hat alle Krebszellen bereits vernichtet. Dennoch folgen weitere Strahlentherapien, insgesamt 22 Sitzungen in zwei Monaten. Dass Gössling den Weg zum zweiten Mal bestreitet, macht die Sache nicht einfacher. Im Gegenteil.
Zu wissen, wie schmerzhaft, wie unerträglich die Strahlentherapie beim ersten Mal war, löst bei ihm große Angst aus. Denn die Brutalität der Strahlentherapie beschreibt Gössling als Höhepunkt aller Schmerzen. Die Bestrahlung verbrennt sein Gesicht, seinen Mund, seine Kopfhaut. Wochenlang kann er nichts essen, sitzt nachts wach. Vor Schmerzen und Erschöpfung.
Heute sagt Gössling über sich selbst, dass er geheilt ist. Und das, obwohl er mit diesen Worten als Krebsarzt sehr vorsichtig ist. Er hat keinerlei Symptome, fühlt sich gesund. Alle sechs Wochen muss er noch zur Immuntherapie, hat regelmäßige Nachsorge. Ansonsten beeinflusst der Krebs sein Leben fast nicht mehr. Er ist Chefarzt der gastroenterologischen Abteilung am Massachusetts General Hospital, lehrt an der Harvard Medical School und forscht zu Therapien und Prävention von Leberkrebs. Und hat mit "Am Leben bleiben" ein Buch geschrieben, dass nicht nur seine Geschichte erzählt, sondern vor allem anderen Betroffenen Mut machen soll.
Denn in all der Zeit habe Gössling sich nie gefragt, warum es ausgerechnet ihn getroffen hat. Krebs sei nicht gerecht, Krebs erfülle keinen Sinn. "Es klingt so banal, aber den Blick immer nach vorne zu richten, hat mir geholfen", sagt Gössling. In den schwersten Zeiten schöpft er Kraft aus seinen Mitmenschen. Aus seiner Familie und ehemaligen Patienten und Patientinnen, an die er während dieser Zeit oft denkt.
Weil ihre Schicksale noch tragischer waren und sie dennoch nicht aufgegeben haben. Und aus Freundschaften. "Es gibt kein richtig oder falsch, wenn es darum geht, wie man für Krebspatienten da sein kann. Das ist einfach individuell. Aber einmal kam ein guter Freund einfach vorbei, und hat bei uns den Rasen gemäht. Und dass ich mich daran noch zehn Jahre später erinnere, zeigt, dass das vielleicht genau das Richtige war."