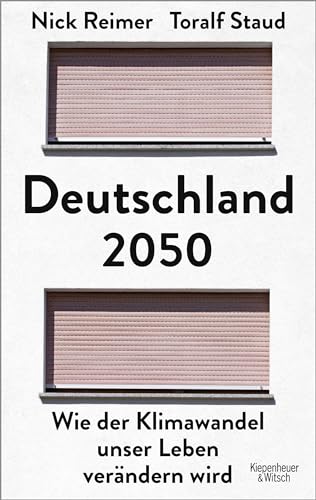Deutschland 2050"Dann ist das schöne Leben futsch"

Klimawandel heißt eben nicht, dass es nur ein bisschen wärmer wird und der Frühling früher beginnt, sagt Toralf Staud. "Es heißt eben auch lebensbedrohliche Hitze im Sommer, Dürren sowie häufigere und stärkere Starkregen."
Deutschland ist noch viel zu wenig auf die Veränderungen vorbereitet, die der Klimawandel bringt, sagt der Journalist Toralf Staud. Zusammen mit seinem Kollegen Nick Reimer hat er ein Buch darüber geschrieben, welche Auswirkungen die Klimakrise hier in Deutschland haben wird - vom menschlichen Körper bis hin zur Stabilität des Gemeinwesens.
ntv.de: Auf dem Cover Ihres Buches sind zwei Fenster mit runtergelassenen Fensterläden abgebildet. Wollen Sie damit signalisieren, dass Sie davon ausgehen, dass die meisten Menschen beim Klima die Schotten dicht machen?
Toralf Staud: Das soll eine Chiffre sein für die Hitzewellen, die wir im Jahr 2050 viel häufiger und viel stärker in Deutschland erleben werden. Wenn es heiß ist und die Sonne kräftig scheint, lässt man ja schon heute klugerweise die Rollläden runter - wenn man welche hat. Das werden wir künftig immer häufiger machen müssen. Und die guten alten Fensterläden werden wohl auch ein Comeback erleben.
Rollläden und Fensterläden als Anpassungsmaßnahme an den Klimawandel dürften nicht reichen. Wie bereitet Deutschland sich auf die Klimakrise vor?
Viel zu wenig. Seit wir das Buch geschrieben haben, gehe ich mit anderen Augen durch die Welt. Wenn man in Berlin Neubauten sieht, die immer noch große Fensterflächen haben, dann kann man nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Die werden sich in den Sommern der Zukunft extrem aufheizen. In Brandenburg sieht man Siedlungen, die direkt an einen Wald heranreichen. Angesichts der drastisch steigenden Waldbrandgefahr in Brandenburg ist das eine wirklich unkluge Siedlungsstruktur. Und ein drittes Beispiel: Im Ahrtal hatten die Dörfer und Kleinstädte über Jahrhunderte eine gute Lage. Im Tal gab es Wasser, dort konnte man eine Wassermühle hinstellen und hatte damit auch Energie. An den Hängen wurden Wein und andere Lebensmittel angebaut. Im stabilen Klima der Vergangenheit war das wirklich eine Top-Lage, doch bei einem veränderten Klima wird es dort regelmäßig hochgefährlich. Auf dies und vieles andere muss sich Deutschland einstellen, da sind viele Anpassungsmaßnahmen nötig. Man muss anders bauen, Verkehrswege anders anlegen, das Gesundheitssystem auf neue Krankheiten vorbereiten, die Wasserversorgung mancherorts umstellen müssen. Und in einigen Gegenden - wo im Inland Sturzfluten oder an den Küsten die steigenden Meeresspiegel drohen - wird man gar nicht mehr bauen können. Darüber wird viel zu wenig diskutiert.
Das Hochwasser in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz hätte fast eine Diskussion über den Klimawandel angestoßen.
Es ist ein häufiges Phänomen, dass Menschen sich vor Diskussionen über den Klimawandel drücken. Manchmal bewusst, häufig unbewusst. Das menschliche Gehirn ist sehr gut darin, unangenehme Themen auszublenden, auch wenn ein solches Verhalten irrational ist. Mit Blick auf die Politik kann ich es mir nur so erklären, dass die Lösungen, die ja eigentlich auf der Straße liegen, bei vielen Politikern eine Scheu hervorrufen, weil sie Angst haben, das komme in der Öffentlichkeit schlecht an. Dabei sagen Umfragen das Gegenteil: Der größte Teil der Bevölkerung findet, dass nicht genug für den Klimaschutz getan wird. Da würde ich mir in der politischen Diskussion und auch im Wahlkampf ein bisschen mehr Mut zur Wahrheit wünschen.
Und die Wahrheit ist?
Wir sprechen so viel über die Kosten von Klimaschutz und welch tiefgreifende Veränderungen er erfordere. Umgekehrt wird ein Schuh draus: Ohne Klimaschutz wird es richtig teuer. Allein im Ahrtal sind an zwei Tagen Schäden in Höhe von sieben Milliarden Euro entstanden!
Was entgegnen Sie, wenn Sie Leute sagen hören, "Klimawandel, super, dann werden die Sommer endlich wärmer"?
Das ist einerseits eine verständliche Haltung hier bei uns in Mittel- und Nordeuropa. Auch ich mag keine kalten, grauen Novembertage, wenn der Himmel wie ein feuchter Scheuerlappen über der Stadt hängt, und ich freue mich, wenn ich den ersten Kaffee schon Ende Februar im Straßencafé trinken kann. Aber Klimawandel heißt eben nicht, dass es nur ein bisschen wärmer wird und der Frühling früher beginnt. Es heißt auch lebensbedrohliche Hitze im Sommer, Dürren sowie häufigere und stärkere Starkregen. Wenn wir den Klimawandel nicht drastisch bremsen, ist das schöne Leben in Deutschland futsch. Dann werden wir in erheblichem Maße an Wohlstand und Sicherheit verlieren.
Es gibt diese Haltung zum Klimawandel, dass schon irgendwie alles gut werde. Haben Sie Fachleute getroffen, Klimaforscher, Medizinerinnen, Forstwirte, Ingenieurinnen, die diese Sicht teilen?
Nicht einen einzigen. Natürlich wird an Strategien geforscht, um besser mit dem veränderten Klima klarzukommen. Wir haben zum Beispiel mit Agrarforschern gesprochen, die sagen ganz klar, Winterweizen - die wichtigste Getreideart in Deutschland - wird ein Verlierer des Klimawandels sein. Winterweizen braucht einen feuchten Herbst, damit die Saat vor dem Winter aufgeht. Doch künftig werden die Böden im Herbst vielfach dafür zu trocken sein. Deswegen experimentieren die Forscher jetzt mit Hirse, Soja und Kichererbsen. Aber die Umstellung ist eine riesige Herausforderung für die Landwirtschaft. Und wir werden uns nur anpassen können, wenn wir den Klimawandel bremsen. Ein starker Klimawandel, auf den wir im Moment noch zulaufen, wird nicht beherrschbar sein. Da ist dann auch die beste deutsche Ingenieurkunst machtlos. Deshalb muss man beides tun: sich an das veränderte Klima anpassen, aber vor allem auch den Klimawandel bremsen.
Sie stellen in Ihrem Buch unter anderem dar, wie der Klimawandel die Sicherheit der Stromversorgung gefährdet - aber nicht so, wie man beim flüchtigen Hinhören denken könnte, durch den Ausstieg aus Kohle und Atomkraft, sondern im Gegenteil: weil konventionelle Kraftwerke durch den Klimawandel in Schwierigkeiten geraten.
Das ist eines der Kapitel, in denen wir eine gute Nachricht haben. Der Klimawandel kann unsere Energieversorgung sicherer machen, wenn wir die Energiewende durchziehen. Schon heute müssen Atom- und Kohlekraftwerke in heißen Sommern - wenn der Energiebedarf für Klimaanlagen am höchsten ist - häufig abgeschaltet oder gedrosselt werden, weil das Flusswasser zum Kühlen nicht ausreicht oder zu warm ist. Windkraft und Solar machen unsere Stromversorgung also stabiler - wenn in der Mittagszeit der Strombedarf für Kühlung am höchsten ist, haben Solarzellen ihre Spitze bei der Stromerzeugung. Es gibt also Herausforderungen des Klimawandels, die mit kluger Politik zu lösen sind.
Dass der Klimawandel verstärkt Migrationsbewegungen auslösen wird, hat sich mittlerweile herumgesprochen - aber dabei wird mehr darauf geachtet, was das für uns im Norden bedeutet, als darauf, dass größere Teile der Erde unbewohnbar werden. Welche Regierung, welche internationale Organisation bereitet sich auf diese Entwicklung vor?
Eine Untersuchung eines internationalen Forscherteams hat ergeben, dass bei ungebremsten Emissionen bis zum Jahr 2070 rund 19 Prozent der weltweiten Landfläche eine Durchschnittstemperatur von 29 Grad haben werden. Bisher trifft das auf 0,8 Prozent zu, etwa auf die Sahara. Bei einer Durchschnittstemperatur von 29 Grad ist es an vielen Tagen so heiß, dass man im Freien nicht arbeiten und sich auch ohne Kühlung kaum fortbewegen kann. Unter Katastrophenschützern, beim Internationalen Roten Kreuz und bei den zuständigen UN-Organisationen gibt es ein hohes Bewusstsein dafür. Bei der Weltbank erscheinen schon seit einiger Zeit Studien dazu, was in einer heißeren Welt passieren wird. Das wird Fluchtbewegungen zur Folge haben, die sich aber zum großen Teil in den jeweiligen Regionen abspielen werden. Man sollte deshalb eher nicht erwarten, dass hunderte Millionen Leute in Europa an die Tür klopfen. Interessieren muss uns das aber trotzdem - zum Beispiel, weil die deutsche Wirtschaft davon abhängig ist, ihre Güter in alle Welt zu verkaufen. In einer sehr viel heißeren Welt werden viele Abnehmerstaaten häufiger von Extremwetter getroffen, etwa von Hurrikans; die werden dann unter Umständen nicht mehr das Geld haben, weiter so viele unserer Produkte zu kaufen. Auch Lieferketten können hitzebedingt zusammenbrechen. Der Nachschub für die deutschen Unternehmen an Rohstoffen, an Aluminium etwa oder Kupfer, wird durch Extremwetter instabiler und teurer.
Ist die Reaktion von Staat und Gesellschaft auf die Corona-Pandemie aus Ihrer Sicht ein Grund für Optimismus, was die Herausforderungen der Klimakrise angeht?
Eines kann man daraus lernen, nämlich wie viel Politik und Gesellschaft tun können. Vor anderthalb Jahren hätte sich niemand vorstellen können, dass es in einem Industrieland einen Lockdown geben kann, dass die allermeisten Leute tatsächlich ihr Verhalten umstellen, um sich und andere zu schützen. Die Masken nerven unsäglich, aber es ist nun einmal wissenschaftlich erwiesen, dass sie die Infektionsgefahr senken. Die weitaus meisten Menschen sehen das ein. Auch die Politik konnte auf einmal zig Milliarden mobilisieren, um zu tun, was nötig ist. Das alles zeigt, dass auch ein Kampf gegen die Klimakrise durchaus möglich ist.
Was denken Sie, wenn Sie sich den deutschen Wahlkampf 2021 anschauen?
Ich bin vor allem ratlos. Die Klimakrise ist der weiße Elefant im Raum, den niemand sehen will. Es ist die zentrale Bedrohung des künftigen Wohlstands, kommt aber viel zu selten vor. Natürlich ist das nicht das einzige Thema, aber es beeinflusst alle anderen. Beispiel Rente: Wenn die Wirtschaft unter den Folgen des Klimawandels leidet, hier in Deutschland oder weltweit, dann werden heutige Diskussionen über Rentenreformen eine Fußnote sein.
Mit Toralf Staud sprach Hubertus Volmer