"Großer Sprung nach hinten"China macht dicht
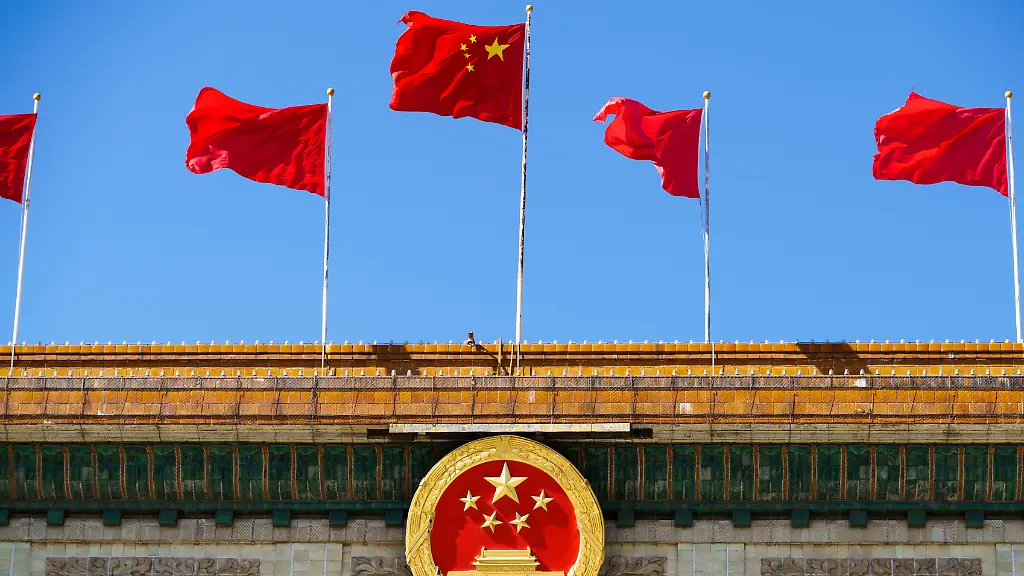
Offiziell vertritt die chinesische Regierung die Haltung, sich der Welt gegenüber zu öffnen. Tatsächlich aber distanziert sie sich immer weiter vom Rest der Welt. Ein gefährlicher, aber gewollter Nebeneffekt ist der stetig wachsende Nationalismus.
Die Chinesische Akademie für Historische Forschung (CAHR) sorgte Ende August für eine regelrechte Kontroverse. Sie verbreitete einen Beitrag über soziale Medien, der sich mit der Außenpolitik der Ming- und Qing-Dynastien beschäftigte. Damals hatten die chinesischen Kaiser ihrem Reich über Jahrhunderte eine politische, wirtschaftliche und kulturelle Distanz zum Ausland verordnet, die China das Attribut "geschlossenes Land" bescherte.
Nicht wenigen Lesern wurde die Parallele zum Jahr 2022 - mehr als 100 Jahre nach dem Ende der Qing-Dynastie - unverzüglich klar. Massive Reise-Beschränkungen ohne Perspektive auf baldige Veränderung halten Chinas Bevölkerung seit mehr als zweieinhalb Jahren faktisch im eigenen Land gefangen. Dabei geht es zwar um die Corona-Pandemie. Zugleich ist allerdings der Aufbau des sogenannten dualen Wirtschaftskreislaufes im vollen Gange. Er soll Abhängigkeiten aus dem Ausland langfristig auf ein absolutes Minimum reduzieren.
Für die Wirtschaft gilt: "Buy Chinese"
Gelistete Firmen kehren von ausländischen Börsen - mehr oder weniger freiwillig - an chinesische Finanzplätze zurück, weil chinesische Regulatoren Druck machen. Besonders die Tech-Industrie will Peking von der Option fernhalten, in den Schwitzkasten ausländischen Kapitals zu geraten. Die Regierung verschärfte zudem im vergangenen Jahr die Lokalisierungsquoten für staatliche Unternehmen. Bei öffentlichen Ausschreibungen müssen die Bewerber immer mehr Komponenten vorweisen, die zu 100 Prozent aus China stammen: "Buy Chinese" als Order an die eigene Wirtschaft. Auch personell werden ausländische Firmen zunehmend gezwungen, chinesisches Führungspersonal einzustellen.
Die CAHR-Autoren des Beitrags mit dem Titel "Eine neue Untersuchung zum Sachverhalt des 'geschlossenen Landes'" argumentieren, dass die einstige Distanzierung des Kaiserreichs eine Notwendigkeit gewesen sei, um die territoriale und kulturelle Sicherheit Chinas aufrechtzuerhalten. Statt "Abschottung" bezeichneten sie die Politik als "Selbstbeschränkung".
Die Reaktionen von Leserinnen und Leser fielen zum Teil sehr kritisch aus und veranlassten die Zensoren, in die Debatte einzugreifen, berichtet die chinesischsprachige Tageszeitung "Lianhe Zaobao" aus Singapur. Manche Kommentatoren warfen den Historikern vor, als Propagandastelle der Regierung den Trend der Gegenwart historisch zu rechtfertigen.
Die Angst der Herrschenden vor dem Machtverlust
Tatsächlich kommt die moderne Form der "Selbstbeschränkung" vielen Chinesen aber eher als Abschottung vor. Über ein privates WeChat-Konto antwortete ein Nutzer mit einem eigenen Essay auf den Beitrag. Der Kernpunkt der Kritik: Es gehe nicht um die nationale Sicherheit, so wie es auch die Ming- und Qing-Kaiser propagierten, sondern um die Angst der Herrschenden vor dem Machtverlust. "Jeder mit ein wenig gesundem Menschenverstand kann den Unterschied erkennen", schrieb der Autor. Innerhalb eines Tages wurde das Stück 100.000 Mal gelesen, ehe die Zensoren einschritten und den Text aus dem digitalen Raum verbannten.
Die allein regierende Kommunistische Partei weist den Vorwurf des Decoupling kategorisch zurück. China, so die offizielle Linie, befinde sich in einem ständigen Prozess der Öffnung gegenüber dem Ausland. In Wahrheit aber konterkariert Pekings Politik diese Behauptung. Vorgaben an Wirtschaft und Industrie sind nur die eine Seite der Medaille. Die massiven Eingriffe in das Bildungsangebot für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die gerne besser Englisch lernen wollen, bedeuten gleichermaßen eine Kehrtwende.
Xi statt Englisch
Im vergangenen Jahr beschlossen ausgerechnet die Behörden in Shanghai, Chinas internationalster Metropole, das Ende von Englisch-Examen in örtlichen Grundschulen. Neu in den Lehrplan der Jüngsten aufgenommen wurden stattdessen "Xi Jinpings Gedanken zum Sozialismus mit chinesischen Merkmalen für eine neue Ära" - ein Buch mit den intellektuellen Ergüssen des Staatschefs, das durch seine vehemente internationale Vermarktung an den Hype um die Mao-Bibel in den 1960er- und 1970er-Jahren erinnert.
Es folgten zudem landesweite Schließungen Tausender privater Bildungsangebote, die den Menschen im Land jahrzehntelang die Möglichkeiten geboten hatten, sich außerhalb des staatlichen Bildungssystems Fremdsprachen - allen voran Englisch - anzueignen. Zynisch kommentierten manche Menschen in Land die Offensive als "Chinas großen Sprung nach hinten". Zumal Englisch noch zu Beginn des Jahrhunderts als Schlüssel zu Chinas wirtschaftlichem Aufstieg von der Staatsführung propagiert wurde.
"Was wir zurzeit erleben, ist eine ideologische Radikalisierung des Landes auf Kosten seiner wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Öffnung", sagt die Berliner Journalistin und Autorin Qin Liwen, die sich in ihrer Arbeit mit Chinas politischer Entwicklung beschäftigt. "Ein gewollter Nebeneffekt dieser Politik ist auch ein stetig wachsender Nationalismus im Land."
Nationalismus auf dem Vormarsch
Die Ausprägungen dieses Nationalismus sind teilweise radikal, wie kürzlich das Beispiel einer Schule in Liupanshui in der Provinz Guizhou offenbarte. Im Rahmen eines schulischen Militärtrainings zur nationalen Verteidigung skandierten die Teenager: "Töten, töten, töten." Gleichzeitig gelobten sie im Chor, jeden umzubringen, der es wagte, die Kommunistische Partei herauszufordern, ganz gleich, wo sich der- oder diejenige auf der Welt aufhalte.
Aufsehen erregte auch die Festnahme einer Chinesin in Suzhou, die für ein Fotoshooting einen japanischen Kimono getragen hatte und deswegen stundenlang verhört wurde. Später stellten die Behörden fest, dass jeder tragen könne, was er wolle, empfahlen aber, sensibel bei der Auswahl von Kleidung zu sein, um Dritte nicht zu provozieren.
Ausländer erfahren zunehmend Ablehnung, wenn sie in Hotels außerhalb der Metropolen einchecken wollen. Manche berichten, dass sie in den vergangenen Jahren regelmäßig in Diskussionen über die Haltung des Westens gegenüber der Volksrepublik verstrickt werden, die sie weder anzetteln, geschweige denn führen wollen. Der wachsende Nationalismus paart sich mit der rigorosen Null-Covid-Politik und veranlasst viele Ausländer, das Land zu verlassen.
"Nationalismus gibt es natürlich auch in anderen Ländern", sagt die Publizistin Qin. "In einer Diktatur aber fehlt dazu das gesellschaftliche Gegengewicht. Solange der Nationalismus die chinesische Führung stützt, wird sie ihn fördern und besänftigende Stimmen abschneiden. In einem solchen Klima multipliziert sich Nationalismus viel schneller, weil öffentlich nicht ausbalanciert wird."