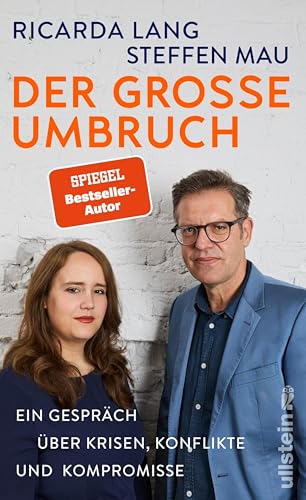Lang und Mau streitenTrifft ein Ost-Soziologe auf die Grüne aus dem Westen ...

Der Rostocker Steffen Mau ist einer der großen Deutschland-Erklärer der Stunde. Die deutlich jüngere Ex-Grünen-Chefin Ricarda Lang sucht nach Erklärungen für die Stimmung im Land. Zusammen haben sie ein Buch geschrieben - und sprechen mit ntv.de über ein paar ihrer Erkenntnisse.
Der Rostocker Steffen Mau ist einer der großen Deutschland-Erklärer der Stunde. Die deutlich jüngere Ex-Grünen-Chefin Ricarda Lang sucht nach Erklärungen für die Stimmung im Land. Zusammen haben sie ein Buch geschrieben - und sprechen mit ntv.de über ein paar ihrer Erkenntnisse.
ntv.de: Herr Mau, Sie wurden 1968 in Rostock in der DDR geboren, Frau Lang ist Jahrgang 1994 und wuchs im wiedervereinten Deutschland in Nürtingen auf. Wie wichtig sind biografische Perspektiven, wenn wir über gesellschaftliche Probleme und Stimmungen reden?
Steffen Mau: Die jeweiligen Erfahrungsschichten zu betrachten, kann helfen, zu verstehen, warum Menschen zu ihren Ansichten und Wahrnehmungen kommen. Das war ja auch der Reiz des Gespräches mit Ricarda Lang: Frau und Mann, West und Ost, Süd und Nord, Politik und Wissenschaft, jung und nicht mehr ganz so jung (beide lachen).
Ihr 2023 erschienenes, mit Thomas Lux und Linus Westheuser verfasstes Buch "Triggerpunkte" haben auffallend viele Spitzenpolitiker gelesen und diskutiert. Sie hätten auch alternative Gesprächspartner zu Frau Lang gehabt …
Steffen Mau: Tatsächlich habe ich auch auf einer Kabinettsklausur der Ampelregierung sprechen dürfen. Aber ich hatte mich auch mit Ricarda immer mal wieder ausgetauscht. Das war ein Ausgangspunkt, an dem wir zusammengefunden haben.
Ricarda Lang: Ich habe schnell gemerkt, Steffen interessiert sich nicht nur für die Meta-Ebene, sondern auch praktisch für die Voraussetzungen gelingender Politik. Steffen wiederum hat gesehen, dass ich über den Rand des Politikbetriebs hinausschauen möchte. Im Gespräch über unsere Biografien wurde dann deutlich, wie oft wir bei anderen Erfahrungen voraussetzen, die sie gar nicht gemacht haben. Mir ist dabei einmal mehr aufgefallen, wie westdeutsch meine Sichtweise häufig ist.
Steffen Mau: So problematisch Identitätspolitik sein kann, so hilfreich ist der Austausch über die unterschiedlichen Erfahrungen, die man gemacht hat. Ich habe das jedenfalls als produktiven Austausch empfunden, weil die unterschiedlichen Prägungen nebeneinanderstehen können.
Wie offen können Sie im Buch sprechen, Frau Lang? Auch aus der zweiten Reihe der Politik heraus haben Sie ja die Befindlichkeiten Ihrer Partei und die eigene Karriere im Kopf.
Ricarda Lang: Es ist mir überraschend gut gelungen, mich von solchen Überlegungen freizumachen und entsprechend selbstkritisch zu sein.
Zum Beispiel?
Ricarda Lang: Wir haben in der Vergangenheit ein sehr kategorisches Bild des "weißen Mannes" gezeichnet: angeblich immer auf der Gewinnerseite, weil er weder von Sexismus noch von Rassismus betroffen ist. Wenn dieser weiße Mann aber zwei Jobs braucht, um über die Runden zu kommen, und in einer abgehängten Region lebt, fühlt der sich bestimmt nicht, als hätte er das große Los gezogen. Wenn es dann noch heißt: "Du musst jetzt aber auch wirklich mal was abgeben von deinen Privilegien"- dann ist die logische Reaktion: Abwehr. Die haben wir abbekommen - und sollten wegkommen von Schubladen und kultureller Distinktion.
In Ihrem Buch wird, wie auch schon in "Triggerpunkte", deutlich, dass vielen großen Aufregerthemen reale oder empfundene Verteilungsungerechtigkeiten zugrunde liegen. Sei es materiell oder etwa die Möglichkeit, mitzureden.
Steffen Mau: Die Verteilungsfragen übersetzen sich häufig in andere Debatten, sei es die Migrationsfrage oder die Diskussionen ums Bürgergeld. Auch die Frage der Klimatransformation verstehe ich als Verteilungsfrage. Die allermeisten Menschen verstehen sehr gut, dass der Klimawandel ein Problem ist. Sie erwarten aber, dass der Umgang der Politik mit diesem Problem auch die Gerechtigkeitsansprüche der Gesellschaft adressiert. Kulturelle Konflikte, Streit um Anerkennung und Diskriminierung sind nicht nur kulturell getrieben, sondern auch handfest materiell. Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt ist ein kulturell codierter Konflikt, aber auch eine materielle Frage. Oder denken wir an die Erzählung, von der Globalisierung profitiere jeder, obwohl das nicht der Erfahrung vieler Menschen entspricht.
Was ist die Folge?
Steffen Mau: Ungleichheit wird beklagt, aber nicht klassenförmig oder im Sinne von Verteilungspolitik interpretiert. Aus der gemeinsamen Erfahrung leitet sich kein politisches Bewusstsein ab und auch kein politisches Programm. Die Linke hat allerdings mit dem Thema zuletzt verstärkt Zuspruch erfahren. In Umfragen geben regelmäßig 80 Prozent der Befragten an, dass die Vermögens- und Einkommensungleichheit zu groß ist. Dieses Empfinden findet politisch aber kein großes Echo.
Ricarda Lang: Das liegt auch daran, dass Ungleichheit in den vergangenen Jahrzehnten immer stärker individualisiert wurde. Die Lesart: Wer wenig hat, hat sich nicht genug angestrengt. In der Folge wurde die Ungleichheit strukturell nicht weiter bearbeitet. Und so entstand ein Vakuum, in das Rechtsextreme hineinstoßen - und materielle Konflikte zu kulturellen umdeuten konnten.
Herr Mau hat die nicht immer stimmige Erzählung von den Vorteilen der Globalisierung angesprochen. Müssen sich da auch die Grünen gemeint fühlen?
Ricarda Lang: Unbedingt. Steffen hat erwähnt, wie sehr materielle Verteilungsfragen etwa zu Migrationsdebatten umgedeutet wurden. Da haben auch wir irgendwann den Anspruch aufgegeben, meinungsbildende Kraft zu sein. Einerseits sind wir dem Diskurs zu sehr hinterhergerannt und haben unsere eigenen Überzeugungen verschwiegen. Andererseits haben wir es gescheut, über konkrete Probleme zu sprechen. Ich bin überzeugt: Es lässt sich für den Schutz von Menschen einstehen, die vor Krieg und Verfolgung fliehen, und gleichzeitig anerkennen, dass der Zuzug der vergangenen Jahre Städte mit angespanntem Wohnungsmarkt unter Druck setzt und bei der Integration vieles verschlafen wurde.
"Triggerpunkte" fand nicht zuletzt viel Beachtung, weil Sie darin schreiben, dass die gefühlt starke Polarisierung des Landes so nicht messbar sei. Warum gelingt uns dann keine Migrationsdebatte mit ruhigerem Puls?
Steffen Mau: Die Aufladung symbolpolitischer Themen befeuert Debatten, die zuverlässig an den eigentlichen Problemen vorbeizielen. Es gibt Probleme bei der Integration, das ist nicht zu bestreiten. Die Überforderung mancher Kommunen ist auch nicht mit Geld zu beheben. Nehmen Sie die Stadt Gera: Seit 1990 von 130.000 auf 90.000 Einwohner geschrumpft. Nun hat sich dort binnen zehn Jahren der Ausländeranteil auf zehn Prozent verfünffacht. Bei den Männern zwischen 20 und 30 Jahren liegt der Ausländeranteil bei 36 Prozent, in einer Stadt, die vorher schon einen Männerüberschuss hatte. Dass diese Gemengelage zu Problemen führt, ist offensichtlich.
Und jetzt kommt das "Aber"…
Steffen Mau: Natürlich! In wenigen Jahren gehen in Thüringen 100 Leute aus dem Arbeitsmarkt raus, für die nur 50 nachrücken. Wie soll das Land ohne Zuwanderung wirtschaftlich überleben? Wir müssen darüber reden, wie Zuwanderer fit werden für den Arbeitsmarkt, ohne über migrationsbezogene Sicherheitsprobleme zu schweigen. Diesen Mittelweg finden wir aber nicht. Seit "Triggerpunkte" haben die Vorbehalte gegen Migration noch einmal zugenommen. Das liegt auch am gesunkenen Vertrauen in die staatlichen Institutionen, dass diese zum Gelingen von Integration beitragen könnten.
Und nun?
Steffen Mau: Es gibt Ansätze. Ich habe über ein Modell in Kanada gelesen, wo Migranten algorithmusbasiert dort untergebracht werden, wo sie ihrer Qualifikation entsprechend am ehesten Arbeit finden. Bei uns bewirkt der Königsteiner Schlüssel, dass junge Männer in strukturschwachen Regionen kaserniert werden, obwohl sie eigentlich gerne arbeiten würden. Es gibt Hebel. Aber politisch schaffen wir es nicht, diese auch zu bedienen.
Das bestärkt ein allgemeines Gefühl, das sich breitmacht: Ohnmacht und wenig Glauben an die eigene Selbstwirksamkeit.
Ricarda Lang: Wir erleben eine doppelte Entwicklung. Auf der einen Seite werden Nebensächlichkeiten hyperpolitisiert. Wochenlang wird sich da öffentlich über Symbole - Stichwort: Veggie-Schnitzel - gestritten. Auf der anderen Seite fehlt dann der Raum für die wirklich wichtigen Debatten: über bezahlbaren Wohnraum, Altersarmut, den Erhalt unserer Lebensgrundlagen. So geht das Vertrauen in die Problemlösungskompetenz und Reformierbarkeit des Staats verloren. Die Initiative für einen handlungsfähigen Staat, an der auch Steffen beteiligt war, hat da wichtige Gegenvorschläge vorgelegt.
Kommen die Vorschläge an?
Steffen Mau: Die Politik hat die Krise der Staatlichkeit erkannt und einige unserer Vorschläge sind ja auch in den Koalitionsvertrag der Bundesregierung eingeflossen. Es gibt auch ein Ministerium für Digitalisierung und Staatsreform, das sich dieser Aufgabe angenommen hat. Aber man muss jetzt ins Umsetzen kommen. Es ist ein guter Ausgangspunkt, zu sagen: "Wir haben eine ähnliche Problembeschreibung". Wir laufen also nicht in völlig andere Richtungen. Wenn das Problembewusstsein sich erhöht und der Druck, dann kommt vielleicht auch irgendwie mal was in Bewegung. Diese Notwendigkeit einer Wiederbelebung trifft aber auf eine große Erschöpfung und Veränderungsmüdigkeit. Das ist ein problematischer Zustand. Im Buch diskutieren wir Antworten darauf.
Zum Beispiel?
Steffen Mau: Es macht nachweislich einen Unterschied, ob Menschen in Veränderungsprozesse einbezogen werden oder das Gefühl haben, Veränderungen von oben übergestülpt zu bekommen. Interessant finde ich: Einerseits ist da dieser Erschöpfungszustand, andererseits der Wunsch nach Disruption; nach einem starken Mann, der auf den Tisch haut. Die politische Dynamik hat da so ein bisschen die Seiten gewechselt: Nicht die progressiven Parteien, sondern rechtsextreme Kräfte werden in Teilen als Problemlöser wahrgenommen, obwohl ihre Konzepte zweifelhaft sind.
Gerade in den neuen Bundesländern wollen viele von Politik vor allem in Ruhe gelassen werden und empfinden vieles, was aus Berlin kommt, als Bevormundung. Wie kommt man da raus?
Steffen Mau: Schon mit den Begriffen Transformation und Reform dürfen Sie den Leuten nicht mehr kommen. Die sind negativ konnotiert und reißen nachweislich Narben auf. In der Lausitz ist das Wort Transformation toxisch. Die Zuversicht, dass Veränderungen Entwicklungen zum Besseren sein könnten, ist weg. Erstens trauen die Menschen den etablierten politischen Akteuren und Institutionen keinen Plan zu, was zu tun ist. Zweitens werden die Akteure und Institutionen als so verknöchert und festgefahren wahrgenommen, dass sie den richtigen Plan auch dann nicht umgesetzt bekämen, wenn sie einen hätten. Derweil ziehen autoritäre Regime wie China mit Wachstumsraten und Technologiesprüngen an uns vorbei und stellen die liberalen Demokratien zusätzlich infrage.
Ricarda Lang: Die Zeit des Politikstils von Angela Merkel ist vorbei. Sie hat den Leuten das Gefühl gegeben, Politik könne ohne Zumutungen auskommen. Olaf Scholz hat das zu kopieren versucht. Da hieß es dann: "Zeitenwende, aber keine Sorge, nicht für dich." Dabei wissen Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen längst, dass das nicht stimmt. Sie spüren die Zumutungen jeden Tag. Die Ehrlichkeit, auch über die Kosten von Veränderungen zu reden und glaubhaft darzulegen, wie diese nicht schon wieder von denjenigen getragen werden, die ohnehin schon wenig haben: das ist der Schlüssel.
Mit Ricarda Lang und Steffen Mau sprach Sebastian Huld