Trotz Milliarden-Investitionen Wie die Digitalisierung der Schulen scheitert
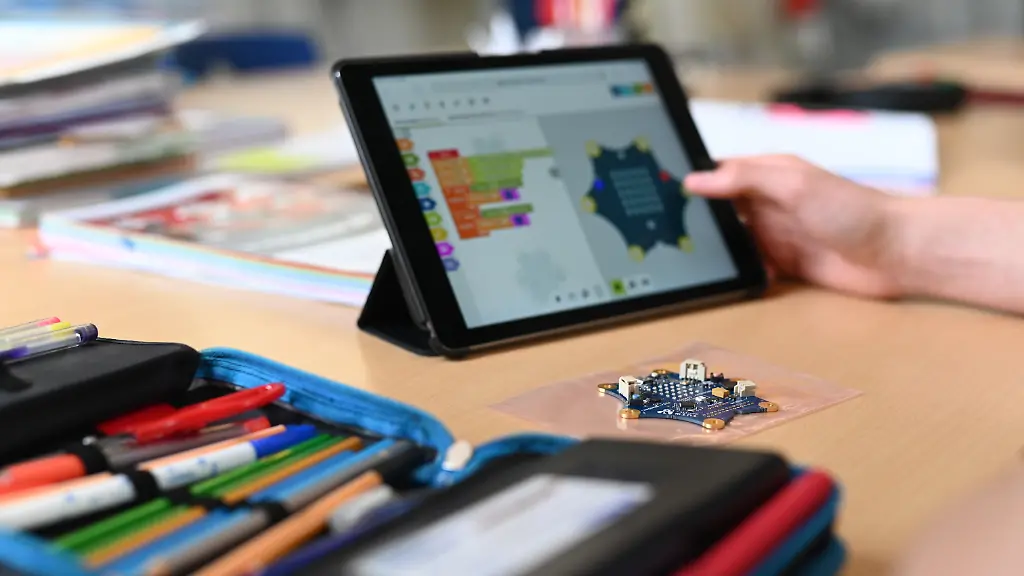
Deutschland muss bei der digitalen Transformation massiv aufholen - vor allem in der Bildung. In der Politik ist diese Erkenntnis durchaus angekommen, sie stellt Milliarden Euro bereit. Doch viele Schulen kommen nicht an das Geld.
Spätestens seit der Pandemie ist klar: Wenn es um die Digitalisierung im Bildungssystem geht, hat Deutschland Nachholbedarf. Die digitale Transformation ist dringend notwendig, da sind sich alle einig. "Der Bund will, dass die Schulen digitaler werden. Alle Bundesländer wollen das auch. Die Schulen wollen das auch. Die Eltern und die Kinder auch", sagt Sarah Henkelmann, die Sprecherin des Netzwerks Digitale Bildung. Doch mehr als ein Jahr, nachdem die Bundesregierung 5,5 Milliarden Euro für die Digitalisierung im Bildungssystem freigegeben hat, ist erst ein Bruchteil davon abgerufen worden. Henkelmann hat eine Vermutung, woran die schleppenden Auszahlungen liegen könnten: "Das Nadelöhr sind wirklich die Schulträger, das muss man sagen."
Der International Computer and Information Literacy Study (ICILS) zufolge gingen 2018 nur 26,2 Prozent der Achtklässler in Deutschland auf eine Schule, an der sowohl für sie als auch für die Lehrer ein WLAN-Zugang verfügbar war. Zum Vergleich: In Dänemark, dem Land mit den höchsten Computer-Kompetenzen der Schüler weltweit, sind es 100 Prozent. Man kann es nicht anders sagen: Deutschland hat die digitale Transformation verschlafen. Und jetzt wird es teuer. "Wir haben jahrzehntelangen Investitionsstau in den Schulen in Deutschland, da ist natürlich ganz viel Nachholbedarf", erklärt Henkelmann.
Bauplan für die Digitalisierung
Genau das sollte der Digitalpakt bewirken - der Digitalisierung einen gewaltigen Schub geben. Milliarden Euro sollten in die digitale Ausstattung der Schulen fließen - von der WLAN-Anbindung bis zur Entwicklung von Lernplattformen war alles dabei. Doch das Geld wurde nicht bedingungslos freigegeben. Um an die Mittel zu kommen, müssen Schulträger Medienkonzepte schreiben und darlegen, wie die Digitalisierungspläne umgesetzt werden sollen. "Das ist auch klug, ein solches Konzept zu schreiben", sagt Henkelmann. "Stellen Sie sich vor, Sie wollen ein Haus bauen und fangen einfach an. Das würden wir nicht machen, ohne erstmal einen Plan zu machen."
Doch für viele Schulen, die ohnehin wenig freie Kapazitäten haben, ist der bürokratische Aufwand zu groß. "Das Umsetzen des Digitalpakts hängt daran, dass die Antragsvoraussetzungen schwer umsetzbar sind", sagt Heribert Werner, Abteilungsleiter für Schule, Kultur und Sport im Landkreis Rhein-Pfalz. "Jede Schule muss ein Konzept schreiben. Das dauert ewig." Der Rhein-Pfalz-Kreis hat bisher noch keine Mittel abrufen können, da er erst vor zwei Wochen grünes Licht für die Konzepte der Schulen erhalten hat.
Andere Schulen haben die Anfangsschwierigkeiten längst überwunden und können daher schneller auf die Mittel zugreifen. Die Grund- und Mittelschule im bayerischen Thalmässing zum Beispiel hat bereits die Hälfte der verfügbaren Mittel beantragt. Allerdings begann die digitale Transformation dort bereits vor 17 Jahren, als alle Räume mit sogenannten Smartboards ausgestattet wurden. Entsprechende Medien- und Digitalisierungskonzepte sind also bereits vorhanden, so Ottmar Misoph, der ehemalige Leiter der Schule. An Schulen ohne Konzepte laufe der Digitalpakt schleppend an. "Die fangen nicht bei null an, sondern bei minus zehn", so Misoph. "Wenn ich jetzt anfange, Medienkonzepte zu schreiben, ist es eine Offenbarung, dass ich mich in den letzten Jahren nicht darum gekümmert habe."
Während Werner durchaus den Mehrwert in einem solchen Konzept sieht, müsse es an der richtigen Stelle gefordert werden. Viele Schulen seien noch in der Anfangsphase der digitalen Transformation. "Wir brauchen eine Verkabelung und wir müssen sehen, dass das Internet schneller wird. Dafür brauchen wir im Moment kein Konzept."
"Ein Land der Leuchttürme"
Die Hürden, eine Schule ans Netz zu bringen, liegen nicht nur in der Finanzierung. Bauaufträge, die zum Teil im fünfstelligen Bereich liegen, müssen nach strengen Regeln vergeben werden - in besonderen Fällen sogar nach EU-Recht, weil bestimmte Summen überschritten werden. Das kann die Kompetenzen von kleinen Schulträgern übersteigen, sagt Henkelmann.
Werner sieht das Problem an einer anderen Stelle. Wegen der Pandemie sind in kleinen Gemeinden die Kapazitäten knapp. Die Hälfte der Mitarbeiter im Landkreis arbeitet inzwischen entweder im Impfzentrum oder im Gesundheitsamt. Dadurch sei die Kapazität für digitale Projekte einfach nicht vorhanden. "Die Umsetzung des Digitalpakts leidet unter der Pandemie."
Wegen Corona haben viele Bundesländer bestimmte Anforderungen ausgesetzt. In Rheinland-Pfalz zum Beispiel kann das Medienkonzept bis zum Ende des Gesamtprojekts im Jahr 2024 eingereicht werden. Außerdem hat die Bundesregierung Soforthilfen in Millionenhöhe für die Anschaffung von Endgeräten freigegeben. Davon sind bereits fast 376 Millionen Euro abgerufen worden. Henkelmann sieht in diesen Entscheidungen einen "sehr, sehr großen politischen Willen", die Digitalisierung voranzutreiben. Die ersten Auswirkungen sind bereits zu sehen. In der zweiten Jahreshälfte 2020 wurden fast 500 Millionen Euro aus dem Digitalpakt abgerufen - im ersten Halbjahr waren es nur 15 Millionen Euro.
Doch der Wille müsse besser verteilt werden. Einzelne Schulen wie die in Thalmässing hätten "eine irrsinnige Strahlkraft nach außen", seien aber in ihrer Region weitgehend isoliert. "Wir sind ein Land der Leuchttürme", sagt Henkelmann. "Ich dringe darauf, gerade im Schulwesen wegzukommen von Leuchttürmen."