Umwelt-Fetisch treibt Bürokratie"Im Bau zählt inzwischen jeder Bodenaushub als Sondermüll"
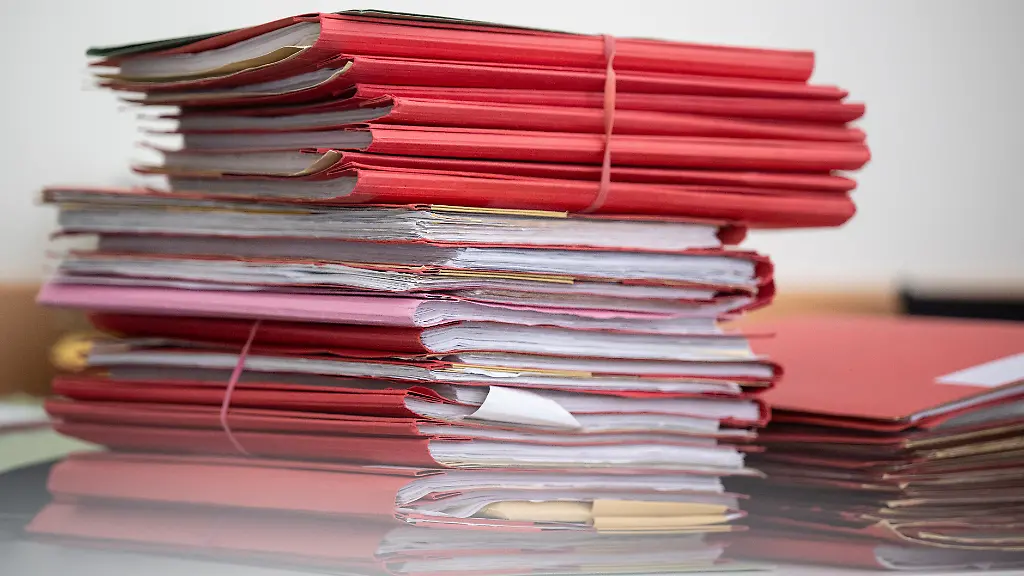
Deutschland hat einen Fetisch für Bürokratie. Als einen großen Übeltäter macht Klaus-Heiner Röhl vom Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) den Umweltschutz aus. "Aus Angst vor Klagen fordern Verwaltungen immer neue Gutachten an", sagt er im "Klima-Labor" von ntv.
Deutschland hat einen Fetisch für Bürokratie. Endlose Planungsverfahren, exzessive Kontrollen von Nachhaltigkeitsstandards und peinlich genaue Datenschutzvorgaben sind gelebte Realität. "In Deutschland ist es häufig einen Tick schlimmer", sagt Klaus-Heiner Röhl vom Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) im "Klima-Labor" von ntv. Als einen großen Übeltäter macht der Ökonom den Umweltschutz aus: "Gerade im Umweltrecht sind eine Menge Regeln verschärft worden, ohne über die Folgen nachzudenken." Die Konsequenzen sind Röhl zufolge fatal, für Wirtschaft und Energiewende: "Aus Angst vor Klagen fordern Verwaltungen immer neue Gutachten an, während Investitionen in andere Länder fließen." Lässt sich der Teufelskreis durchbrechen? Röhl empfiehlt einen Blick zu unseren pragmatischen Nachbarn. Er schlägt außerdem einen Einigungszwang für Ämter und Behörden vor, Boni für fleißige Verwaltungsmitarbeiter und Mut zur regulatorischen Lücke: "Manchmal ist keine Regelung die beste Regelung."
ntv.de: Haben wir einen Bürokratie-Fetisch? Sind wir besessen von Regeln und Vorschriften oder ist das in anderen Ländern genauso schlimm?
Klaus-Heiner Röhl: In Deutschland ist es häufig einen Tick schlimmer, das zeigt der innereuropäische Vergleich. Wir wollen EU-Recht sehr genau und umfassend umsetzen. Die skandinavischen Länder oder die Niederlande bekommen vieles einfacher hin.
Wir machen es uns schwerer als nötig?
In der Umsetzung bestehender Vorschriften machen wir es uns schwerer. Gleichzeitig hat auch die Zahl der Gesetze zugenommen.
Haben Sie ein Beispiel dafür?
Für Unmut sorgt immer wieder die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Der Schutz personenbezogener Daten ist eine gute Sache, deutsche Datenschützer fassen allerdings auch personenbeziehbare Daten von Maschinen darunter. Die benötigen wir etwa für Windenergieanlagen. Es fallen viele Daten für die Wartung der Anlage an oder um die schwankende Einspeisung mit der Nutzung abzugleichen. Die fallen prinzipiell nicht unter die DSGVO, für deutsche Datenschützer aber schon, weil man sie mit einer an der Maschine arbeitenden Person abgleichen könnte.
Und das gibt’s in den Niederlanden nicht?
Andere Länder setzen die DSGVO eins zu eins pragmatisch um. In Schweden gibt es etwa den gläsernen Bürger, viele Daten werden beim Staat gesammelt. Staatliche Stellen können auf diesen einheitlichen Datenbestand von Bürgern und Unternehmen zugreifen. Wir dagegen bauen selbst zwischen staatlichen Stellen Datenschutzhürden auf, was dazu führt, dass die eine Hand nicht weiß, was die andere tut. Das europäische Recht gilt in Schweden aber trotzdem.
Den gläsernen Bürger lehnen wir in Deutschland aus historischen Gründen ab. Menschen, die in einem Überwachungsstaat mit der Stasi aufgewachsen sind, wollen das verständlicherweise nicht. Wir machen es uns aber auch in anderen Bereichen schwerer?
Ja, das resultiert zum Teil aber auch aus der föderalen Struktur: Ein Gesetz wird auf Länder und Kommunen heruntergebrochen, die verschiedene Regelungen entwickeln. Unternehmen, die in mehreren Bundesländern tätig sind, müssen sich dann an mehrere Umsetzungen halten. Bei europäischen Vorgaben versuchen wir immer noch eins draufzusetzen. Das ist das sogenannte "Gold Plating", obwohl es die Goldmedaille eher für eine schnelle und effiziente Verwaltung geben sollte.
Wann hat das begonnen? Gab es einen bestimmten Anlass?
Nein. Wir haben sogar sinnvolle Anläufe unternommen, um Bürokratie zu verringern. 2006 hat die Regierung Merkel das niederländische Modell der Kostenmessung für administrative Lasten übernommen. Das betrifft die Umsetzung in den Unternehmen: Was müssen sie nachhalten? Welche Berichte müssen sie anfertigen? Welche Kosten fallen für Meldungen bei Ämtern an? Diese Kosten wollte man nach niederländischem Vorbild um 25 Prozent verringern. Diese Messung war und ist ein Erfolg. Wir haben uns auf den richtigen Weg begeben …
… und dann verlaufen?
Ja. Oder es sind neue Regelungen hinzugekommen. Beim Bau von Windrädern oder beim Verlegen von Kabeln für die Energiewende sind immer längere Planungs- und Genehmigungsverfahren ein Riesenproblem. Die sind kontinuierlich schwieriger geworden, weil Verwaltungen ständig neue Gutachten anfordern, um sich abzusichern. Das dauert ewig.
Um Sicherheitsstandards zu überprüfen?
Ein Thema nach dem Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine waren Brennstoffwechsel von Industrieanlagen. Für den Wechsel, aber auch alle anderen Änderungen, benötigt man eine fachliche Genehmigung, muss aber auch das Umweltrecht, den Arbeitsschutz, den Denkmalschutz und andere Rechte berücksichtigen. Die überlagern sich in so einem Planungsverfahren. Deswegen ist die Möglichkeit, einen Fehler zu machen, der erfolgreich von Gegnern des Projektes beklagt werden kann, relativ groß. Dieser Wille, gegen alles und jeden zu klagen, hat in den letzten 20 Jahren massiv zugenommen.
Woher kommt das? Gibt es zu viele Juristen in Deutschland?
Die Juristen führen nur aus. Meistens sind es Umweltverbände, weil deren Möglichkeiten, Klage zu erheben, massiv ausgeweitet wurden. Und ist eine Klage erfolgreich, ist der Verwaltungsmitarbeiter, der das genehmigt hat, immer der Dumme. Also fordert er lieber immer noch ein Gutachten an, um sich abzusichern. Alles wird endlos verzögert, während Investitionen in andere Länder fließen, wo es flotter geht.
Das klingt so, als wäre der Umweltschutz schuld an der deutschen Bürokratie …
Gerade im Umweltrecht sind eine Menge Regeln verschärft worden. Das hatte gesellschaftliche Gründe, war aber auch der Wunsch von Politikern. Es wurde nicht über die Folgen nachgedacht, sondern nur das Positive propagiert. Im Bau zählt durch die Verschärfung der Grenzwerte inzwischen jeder Bodenaushub als Sondermüll. Das ist absurd. Tiefbaufirmen kriegen das Zeug nicht mehr entsorgt. Im Wohnungsbau wird deswegen fast nur noch auf Bodenplatten gebaut, Tiefgaragen und Keller lässt man weg.
Umweltschutz gibt es aber auch in anderen EU-Staaten.
Dort wird aber zielorientierter gearbeitet. Dänemark holt etwa bei Projekten wie der Fehmarnbeltquerung alle Beteiligten an einen Runden Tisch. Die klären auch mit Umweltverbänden ab, was geht und was nicht und dann beginnt relativ flott die Planung. Dort gibt es danach aber auch keine Klagen der beteiligten Verbände. Das war früher auch in Deutschland so: Eine Klage durfte nur Einwände berücksichtigen, die im Planungsverfahren angemeldet wurden. Das hat man abgeschafft, mit der Folge, dass immer neue Klagegründe vorgebracht werden. Wenn das Ziel ist, gemeinsam zu einer schnellen Lösung zu kommen, sollte man das wieder ändern.
Die Bundesregierung gewährt neuerdings Projekten von nationalem Interesse einen Vorrang. Bei denen werden gewisse Rechte ausgesetzt, um die Planung zu beschleunigen. Das ist aber kein nachhaltiger Bürokratie-Abbau. Welche Möglichkeiten sehen Sie, um aus diesem Teufelskreis wieder herauszukommen?
Wir müssen ein dickes Brett bohren und an vielen Punkten ansetzen. Bei der Digitalisierung macht die Regierung das mit der Planungsbeschleunigung bereits. Wenn es ein digitales Verfahren gäbe, bei dem alle beteiligten Fachbehörden auf den gleichen Datenbestand zugreifen könnten, hätten wir zumindest das Problem umgangen: Im Genehmigungsverfahren wandern keine Aktenberge mehr von Verwaltung x zu Verwaltung z und bleiben dann auf einem Tisch liegen, weil jemand krank oder im Urlaub ist.
Gäbe das nicht wieder Ärger mit dem Datenschutz?
Nein. Wenn man die Daten in einer Cloud mit entsprechenden Zugriffslösungen sichert, geht das. Das wurde in der Corona-Pandemie als Sonderlösung begonnen. Es müssen aber auch Formulierungen im Umweltrecht, im Planungsrecht und anderen Bereichen angeglichen werden, denn derzeit sehen die Verwaltungen an der einen Stelle eine Kann-Bestimmung und an der anderen eine Soll-Bestimmung und fragen sich, ob das rechtlich eine unterschiedliche Bedeutung hat. Ich wäre auch dafür, den Mitarbeitern einen Anreiz für die Bearbeitung von Anträgen zu bieten. Denn bisher droht nach jeder Genehmigung nur Ärger, falls geklagt und die Genehmigung wieder kassiert wird.
Ein Bonussystem für Verwaltungsmitarbeiter?
Ja, ein Bonus für gefällte Entscheidungen. Dann gäbe es einen Anreiz für eine positive Entscheidung. Zudem würde ein Zwang zur Einigung zwischen den Ämtern helfen. Ich kenne mehrere Fälle, in denen sich die Denkmalschutz- und Naturbehörde endlos den Schwarzen Peter zugeschoben haben, an der Ostseeküste auf dem Fischland Darß etwa. Das ist ein Naturschutzgebiet. Der Leuchtturm wurde bis zur denkmalgerechten Sanierung als Funkmast genutzt. Danach hat die Denkmalschutzbehörde verboten, die Mobilfunkantenne wieder draufzusetzen. Also wurde beantragt, die Antenne daneben im Naturschutzgebiet aufzustellen. Das hat die Naturschutzbehörde verboten - mit Verweis auf den Leuchtturm. So geht es nicht. Die müssen sich einigen.
Politikerinnen und Politiker aller Parteien versprechen seit Jahren, dass es besser wird. Passiert etwas?
Die erste EU-Kommission von Ursula von der Leyen war sehr regulierungsfreudig. Es gab einen neuen Schwung an Wünsch-dir-was-Regulierung wie das Lieferkettengesetz. Jetzt sehen die Leute plötzlich, was mit der europäischen und deutschen Wirtschaft passiert und fordern einen Trend in die Gegenrichtung. Das ist politisch machbar.
Der Katalysator für weniger Bürokratie ist die lahmende Wirtschaft?
Das erhöht den Druck. Solange Gewinne sprudeln, sagen Unternehmen: Bürokratie ist nervig, aber das wuppen wir. Wenn es schlecht läuft, sagen sie dagegen: Ohne diese oder jene Regelung würde es uns trotz der nicht so tollen Auftragslage besser gehen. Bürokratie-Abbau kann die Wirtschaft voranbringen und Investitionen erleichtern.
Einfach nur Regeln abzuschaffen, kann doch aber nicht die Lösung sein.
Doch. Manchmal ist keine Regelung die beste Regelung.
Zeigt die Vergangenheit nicht, dass Dinge dann an Stellen gebaut werden, wo sie Schaden in der Natur anrichten oder Chemikalien einfach in den Boden oder in den Fluss abgelassen werden?
Solche Dinge sind generell illegal. Anstatt dann noch eine Regel und noch eine Regel zu ergänzen, sollte man die Überwachung verstärken. Es ist auch ein Totschlagargument zu sagen: Hier ist dieses und jenes passiert, deswegen brauchen wir für 20 Millionen Unternehmen in der EU eine weitere Regelung, die in jedem Betrieb mindestens eine halbe Arbeitskraft bindet und volkswirtschaftlichen Schaden anrichtet. Man muss nicht alle Regeln abschaffen, aber immer noch eine zu machen, führt zum Regelungsinfarkt. Dem stehen wir jetzt schon ein bisschen gegenüber.
Mit Klaus-Heiner Röhl sprachen Clara Pfeffer und Christian Herrmann. Das Gespräch wurde zur besseren Verständlichkeit gekürzt und geglättet. Das komplette Gespräch können Sie sich im Podcast "Klima-Labor" anhören.