Experte zu ChatGPT"KI wird sich positiv auf den Arbeitsmarkt auswirken"
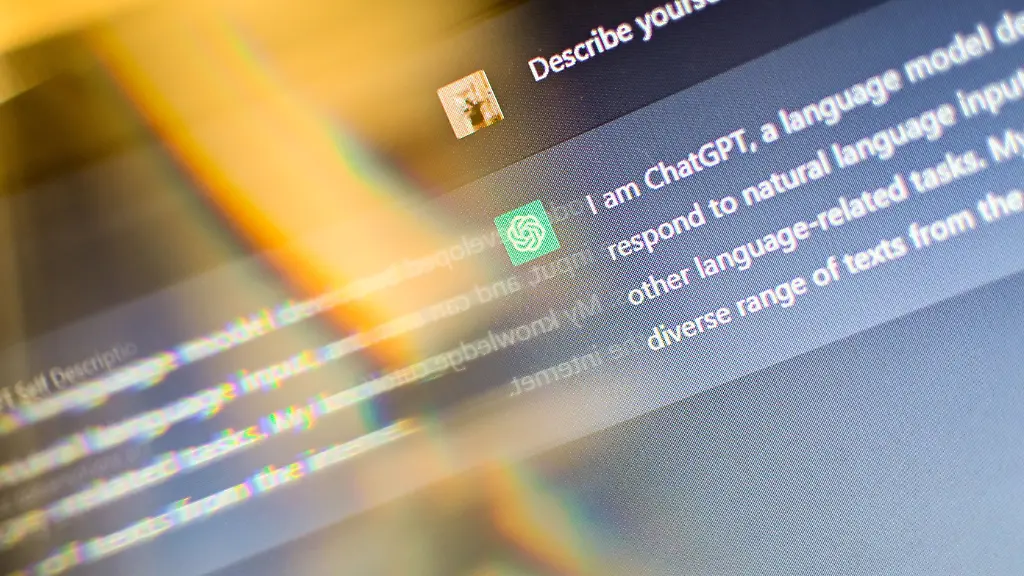
Seit Wochen sorgt ChatGPT für Aufsehen. Das KI-Modell kann Texte schreiben, Fragen beantworten und programmieren - hat aber auch noch einige Tücken. Im Interview mit ntv.de erklärt KI-Experte Albrecht Schmidt, warum er Parallelen zur Entstehung des Internets sieht.
Seit Wochen sorgt ChatGPT für Aufsehen. Das KI-Modell kann Texte schreiben, Fragen beantworten und programmieren - hat aber auch noch einige Tücken. Der Informatik-Professor Albrecht Schmidt erforscht an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, wie Computer und Mensch künftig zusammenarbeiten. Im Interview mit ntv.de erklärt er, warum er ChatGPT in Deutschland für unterschätzt hält und warum er Parallelen zur Entstehung des Internets sieht.
ntv.de: Herr Schmidt, was ist Ihre Einschätzung: Führt in 15 Jahren eine Künstliche Intelligenz (KI) mit Ihnen dieses Interview?
Albrecht Schmidt: Ich glaube, ich spreche weiter mit Ihnen. Wir werden aber beide KI nutzen, so wie wir jetzt ein Videotool verwenden. Menschen werden sich weiterhin austauschen, aber vielleicht auf einem höheren intellektuellen Niveau. Mit neuen Werkzeugen hat sich die Menschheit immer weiterentwickelt: Mit der Erfindung des Rads konnten etwa größere Lasten transportiert werden, die Schrift hat die gesamte Kultur verändert. Viele Sachen werden wir nicht mehr von Mensch zu Mensch machen, weil sie sich durch KI automatisieren lassen. Deshalb herrscht bei vielen Startups gerade Begeisterung. Wir sind gerade an einem Punkt, an dem neue Werkzeuge entstehen - vielleicht auch die neuen Googles oder Microsofts. Das Potenzial, das dahintersteckt, ist einfach phänomenal.
Ein Interview mit KI-Unterstützung: Wie könnte das aussehen?
Es wird weiter Kommunikation geben: Journalisten haben weiter Ideen und denken sich mithilfe von KI-Werkzeugen Fragen und eine Struktur aus. Auch die Verschriftlichung liefe anders ab. Die KI würde merken, an welchen Stellen nachgefragt wird, wann sich die Körpersprache verändert. Am Ende hätten Sie 50 verschiedene Varianten für 50 verschiedene Zielgruppen.
Nicht alle teilen Ihre Begeisterung. ChatGPT ist nicht perfekt: Es spuckt manchmal falsche Antworten aus.
Als ich angefangen habe zu studieren, entstanden die ersten Webserver und -browser. Das hat alles nicht sonderlich gut funktioniert. Wenig später wurde uns bewusst, dass das, was gerade passiert, wirklich spannend war. Auf einmal konnte man mit dem Internet Dinge tun, die vorher nicht möglich waren. Doch aufgefallen ist das erst, nachdem die Kinderkrankheiten beseitigt waren. Heute ist ChatGPT bei uns in den Lehrveranstaltungen ein großes Thema: Viele Studierende, die sich gerade überlegen, was sie mit ihrem Leben anfangen wollen, beschäftigen sich damit. Es stellen sich gerade fundamentale Fragen, so wie es vor 30 Jahren war, am Anfang des World Wide Webs.
Vereinfacht gesagt: Wie funktioniert ChatGPT?
Bei ChatGPT handelt es sich um ein Sprachmodell. Dieses Modell wird mit einem enorm großen Datensatz trainiert. Es wird von über 45 Terabyte gesprochen - jedoch nur ein kleiner Teil des gesamten Internets. Zum Vergleich: Alle Texte der deutschen Wikipedia-Seite sind etwa 0,006 Terabyte groß. Bei den Daten handelt sich vor allem um Texte. Jeder davon hat eine bestimmte Struktur, die Position jedes Wortes spielt eine Rolle. Dort setzen dann sogenannte Transformer-Modelle, also Neuronale Netze an, die mit diesen riesigen Textmengen gefüttert werden. Die KI lernt nicht nur den Text und die Worte, sondern auch deren Anordnung. Man kennt das vielleicht vereinfacht vom Handy. Wenn ich zwei Wörter schreibe, wird mir ein drittes schon vorgeschlagen. ChatGPT geht aber noch einen Schritt weiter. Das Modell hat insgesamt 175 Milliarden Parameter, um Sätze zu erkennen und Texte zu generieren.
Ein weiterer Kritikpunkt bei ChatGPT ist, dass die Quellen nicht bekannt sind.
Nehmen wir einmal an, ich stelle der KI eine Frage und bekomme zwar eine Antwort, aber keine Quelle. Bei politischen und wissenschaftlichen Themen ist es deutlich einfacher, im Anschluss die Quelle herauszufinden. Ich könnte die KI auch direkt danach fragen, doch bei ChatGPT funktioniert das momentan noch nicht. Aber wenn ich frage, wie lange der nächste Supermarkt geöffnet ist, spielt die Quelle auch keine Rolle. Übrigens ist das der Unterschied zu Google: Wenn ich dort eine Frage eingebe, werden mir zahlreiche Webseiten hingeworfen und ich muss mir die Antwort selbst heraussuchen. Wir haben uns daran gewöhnt, dass das normal ist.
Bei KI-Modellen gibt es häufig Probleme mit Rassismus und Sexismus. Wie kann das verhindert werden?
Je nachdem, mit welchen Texten ich das KI-Modell trainiere, verändert sich das Endergebnis. Wenn ich einen rassistischen Text hineingebe, die es im Internet ja durchaus gibt, kommt auch ein rassistischer Text raus. So wie der Mensch Vorurteile hat, übertragen die sich auf KI-Modelle. Aber es ließen sich Modelle bauen, die diese Vorurteile aufspüren und entfernen könnten.
Für wie ausgereift halten Sie ChatGPT?
Es kommt auf die Fragestellung an: An manchen Stellen ist es schon sehr ausgereift. Zum Beispiel das Programmieren von simplen Dingen. Gerade, wenn es um den ersten Code geht, ist ChatGPT schon gut. Oder wenn es darum geht, zu einem bestimmten Thema einen kurzen Text zu schreiben. Das Ergebnis ist dann meistens nicht genial, aber auch nicht schlecht. Etwas, was schon jetzt sehr gut funktioniert, sind Briefvorlagen, sogenannte Templates. Ich kann dem KI-Modell einige Informationen geben und es schreibt etwa einen Brief an einen Handwerker. Gerade, wenn Deutsch nicht meine Muttersprache ist, kann das eine riesige Hilfe sein.
Wie könnte das im Alltag funktionieren?
Microsoft hat angekündigt, kräftig in ChatGPT zu investieren und die KI-Anwendung in seinem Office-Paket zu integrieren. Um beim Beispiel zu bleiben: Ich könnte also meinem Mailprogramm sagen, einem Handwerker eine Anfrage für eine neue Wohnungstür zu schreiben. Ich kann dann immer noch sagen, dass mir etwas noch nicht gefällt.
Das macht Prozesse effizienter, könnte aber auch Arbeitsplätze kosten, oder?
Das glaube ich nicht. Ich denke, das könnte sich positiv auf den Arbeitsmarkt auswirken - mit zwei möglichen Richtungen. Überall in der Wirtschaft entstehen gerade neue Aufgaben. Doch viele Unternehmen finden gar nicht die Leute, um diese Stellen zu besetzen. In der Software-Entwicklung gibt es Firmen, die Vorhaben nicht umsetzen können, weil dafür die notwendigen Entwickler fehlen. Das heißt, wenn wir die simplen Dinge automatisieren können, hätten wir dort mehr Zeit, wo momentan Ressourcen fehlen.
Und die zweite Richtung?
KI-Modelle könnten Menschen helfen, die etwas nicht gut können. Wer sich auf Deutsch nicht gut ausdrücken oder schreiben kann, aber sonst gut ausgebildet ist, kann in einem Unternehmen nicht überall eingesetzt werden. Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir beim Schreiben am Computer die Rechtschreibhilfe verwenden. Das setzt daran an: Wer kein gutes Deutsch schreiben oder sprechen kann, könnte mithilfe von KI-Modellen auch hochwertige Texte schreiben oder im Kundenservice arbeiten.
Gibt es Branchen, die davon besonders profitieren könnten?
Davon könnten ganz viele Branchen profitieren. Es wird zum Beispiel einfacher sein, einen Geschäftsbericht zu erstellen. Das könnte künftig ein KI-Modell übernehmen und jemand aus dem Management kontrolliert das anschließend. Ich kann zahlreiche weitere Beispiele nennen. Im Journalismus werden die Menschen dort gebraucht werden, wo es auf Qualität ankommt. Auch für die Gesundheitsbranche könnte das ein Gewinn sein: Ärzte müssten weniger Zeit damit verbringen, Berichte zu schreiben. Die Entwicklung wird ähnlich wie beim Internet sein. Wer lernt, mit KI-Modellen zu arbeiten, wird einen Vorteil haben. Und die anderen werden den Konkurrenzdruck spüren.
Geht dabei nicht auch das Menschliche aus der Kommunikation verloren?
Ähnliche Befürchtungen gab es schon, als die Wäsche nicht mehr am Fluss, sondern in einer Waschmaschine gewaschen wurde und es keinen gemeinsamen Waschtag mehr gab. Wir Menschen unterhalten uns dann auf anderen Wegen. Die Frage ist, wie viel Energie ich für meine Kommunikation aufwende. Es kann sein, dass ich mir sehr viel Zeit nehme, um eine Anfrage an einen Handwerker zu schreiben. Wenn dort aber nur eine Software die Informationen ausließt, lohnt sich der Aufwand nicht. Es bleibt also mehr Zeit, um interessante Sachen zu schreiben oder zu lesen.
Was ist Ihre Prognose? Wie lange dauert es noch, bis wir an dem Punkt sind, den Sie gerade skizziert haben?
Mein Gefühl ist, dass wir in den nächsten zehn Jahren eine Entwicklung erleben, die parallel zum Beginn des Internets verläuft - also von Anfang der 1990er-Jahre bis Anfang der 2000er. Hinzu kommt wahrscheinlich eine ähnlich starke Veränderung der Businessprozesse. ChatGPT ist ja nicht das einzige KI-Modell. Mit Dall-E gibt es Bildgenerierung, es gibt Modelle, die automatisch programmieren können oder Texte verstehen. Damit könnten viel mehr Menschen auch viel mehr Software entwickeln. Die Anwendung von KI-Modellen wird in den nächsten drei, vier Jahren holprig sein. Vielleicht werden wir auch einen "Wilden Westen" erleben, wie es zu Beginn des Internets war. Das ist noch reine Spekulation, aber ich denke, dass wir gegen Ende des Jahrzehnts die erste neue Technologie mit einem oder mehreren neuen Big Playern haben werden.
Ihrer Ansicht nach ist ChatGPT in Deutschland noch sehr unterschätzt, haben Sie dafür eine Erklärung?
Nicht nur in Deutschland wird das KI-Modell unterschätzt. Viele achten momentan darauf, was noch nicht klappt - und da ist Deutschland relativ weit vorne dabei. Und das ist auch wichtig. Aber man sollte nicht unterschätzen, wie schnell KI-Anwendungen dabei helfen können, um Prozesse zu optimieren.
Mit Albrecht Schmidt sprach Sebastian Schneider