Soziologe zu großem Klimastreik"Der Druck muss aufrechterhalten, sogar erhöht werden"
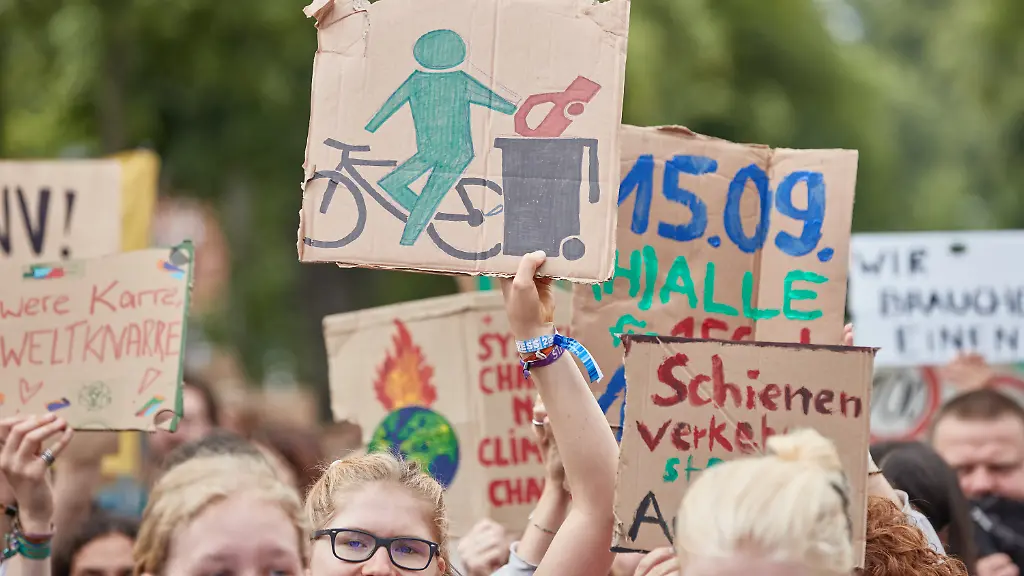
An diesem Freitag ruft Fridays For Future zum globalen Klimastreik auf - in Deutschland werden voraussichtlich Zehntausende Menschen auf die Straße gehen. Dennoch ist die Protestbewegung in einer schwierigen Lage, wie der Soziologe Dieter Rucht im Interview mit ntv.de erklärt. Er rechnet mit einer Radikalisierung - allerdings nicht in Richtung Gewalt.
An diesem Freitag ruft Fridays For Future zum globalen Klimastreik auf - in Deutschland werden voraussichtlich Zehntausende Menschen auf die Straße gehen. Dennoch ist die Protestbewegung in einer schwierigen Lage, wie der Soziologe Dieter Rucht im Interview mit ntv.de erklärt. Er rechnet mit einer Radikalisierung - allerdings nicht in Richtung Gewalt.
ntv.de: An diesem Freitag ruft Fridays For Future zum globalen Klimastreik auf - es ist das erste Mal seit Langem, dass es so etwas gibt. Ist das ein letztes Aufbäumen? Ist die große Welle des Klimaprotestes eigentlich schon abgeebbt?
Dieter Rucht: Insgesamt ist die Welle des Klimaprotestes nicht abgeebbt. Denn die schließt ja auch die Letzte Generation mit ein, die seit zwei Jahren im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses steht. Wenn ich Ihre Frage aber nur auf Fridays For Future beziehe, dann ist die Welle in der Tat abgeebbt. Der Höhepunkt war im September 2019, aber nur wenige Monate später war bei einem Aktionstag schon ein Abschwung sichtbar. Jetzt ist die große Frage, wie es weitergehen soll. Da bietet sich aber keine Patentlösung an.
Haben Sie trotzdem eine Idee?
Die Bewegung muss aktionistischer werden. Fridays For Future könnte sein Spektrum verbreitern und beispielsweise, wie Greenpeace, selbst Expertisen fördern und mit aufgeschlossenen Parteien zusammenarbeiten. Solch eine Arbeit ist aber weniger provokativ oder aufsehenerregend.
Wie ist es bei der Letzten Generation? Deren Aktionen sorgen zumindest bei einem großen Teil der Bevölkerung für Ermüdung - vorsichtig formuliert.
Die Situation ist in der Tat merkwürdig. Vier Fünftel der Bevölkerung unterstützen einen entschiedeneren Klimaschutz. Ebenso viele lehnen aber diese Protestformen ab, also die Klebeaktionen oder das Beschmutzen von Kunstwerken. Man kann nicht ignorieren, dass man mit solchen Aktionen eine große Mehrheit der Bevölkerung gegen sich aufbringt. Man kann die Autofahrer nicht insgesamt für die Probleme verantwortlich machen. Schon gar nicht ist es überzeugend, wenn man sich Museumsobjekte als Zielscheibe auswählt. Das ist nicht vermittelbar.
Bis auf die AfD haben alle Parteien bis hin zur Union das Thema Klimaschutz mittlerweile aufgegriffen und geben ihm einen großen Stellenwert. Brauchen wir diesen Protest überhaupt noch?
Der Druck muss schon aufrechterhalten, sogar noch erhöht werden. Die Reaktionen der Regierenden sind zu zögerlich, wenngleich die verbalen Bekenntnisse nach wie vor da sind, entschiedener voranzugehen. Ich gehe davon aus, dass es weiter Straßenproteste, Störaktionen und Regelverletzungen geben wird. Vielleicht wird ein Teil davon noch offensiver, sprich: radikaler.
Beobachten Sie die Radikalisierung jetzt schon?
Wir haben bereits einzelne Sabotage-Akte gesehen, zum Beispiel den Anschlag auf die Bahninfrastruktur in Hamburg. Dass wir eine Welle von Sabotage-Akten oder gar eine grüne Klima-RAF erleben, halte ich aber für wenig wahrscheinlich. Der Vorwurf der Klima-RAF ist ohnehin maßlos übertrieben, weil die tatsächliche Rote-Armee-Fraktion Bomben gelegt hat, entführt und erpresst und Menschen ermordet hat. Damit haben die Klimaschützer nichts zu tun. Sie ziehen eine klare Grenze: Über zivilen Ungehorsam werden wir nicht hinausgehen. Ziviler Ungehorsam aber ist per Definition gewaltfrei.
Aber was heißt ziviler Ungehorsam? Was nimmt man sich da heraus? Man stellt das eigene Anliegen über alles andere. Stellt man damit nicht auch Demokratie und Rechtsstaat infrage? Man sagt doch letztlich: Die Mehrheiten im Bundestag sind zweitrangig.
Das sehe ich anders. Es wäre unangemessen, zu jedem Anliegen Aktionen zivilen Ungehorsams zu starten. Das muss wohlüberlegt und dosiert sein. Es reicht nicht, sich einfach auf sein Gewissen zu berufen. Eine dramatische Problemlage muss gegeben sein, um diese Formen als legitim erscheinen lassen zu können. Man muss die öffentliche Auseinandersetzung suchen und versuchen, die Öffentlichkeit zu überzeugen. Man muss seine Taten begründen und sich mit Gesicht zu ihnen bekennen. Es gehört aber dazu, dass man das demokratische Rechtssystem im Prinzip anerkennt.
Wie das? Sie tun doch das Gegenteil.
Nein, ziviler Ungehorsam bedeutet eben keine Ablehnung von Demokratie und Rechtsstaat. Man erkennt diesen prinzipiell an. Aber an bestimmten Stellen beruft man sich auf höhere Güter und sagt: An dieser Stelle werden wir das Gesetz missachten. Das ist aber keine generelle Missachtung der Rechtsordnung. Fridays For Future berufen sich ja beispielsweise auch auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutz.
Manch einer sagte auch, zum Beispiel FDP-Chef Christian Lindner, man könne in eine Partei eintreten. So könne man in der Demokratie etwas bewegen.
Das tun die jungen Leute zum Teil ja auch. Aber manche entscheiden sich bewusst dagegen, weil man als einzelner junger Mensch in einer Partei eben erst mal nicht viel bewegen kann. Das war auch nach 1968 so. Damals sagten manche: In der Parteiarbeit werde ich zerrieben, da bin ich nur ein kleines Rädchen im Getriebe. Unterm Strich erschien damals vielen der Druck von außerparlamentarischen Bewegungen vielversprechender.
Die Studentenbewegung der 68er ist längst legendär und sagenumwoben. Hat es Sie eigentlich überrascht, dass ausgerechnet die heutige, vermeintlich ichbezogene, konsumorientierte Generation so einen auch zahlenmäßig massiven Protest auf die Beine gestellt hat?
Ja, durchaus. Mich hat auch die Professionalität und Effizienz der Organisation überrascht. Die quantitative Mobilisierung ist übrigens viel größer als 1968. Es gab bei Weitem nicht so viele 68er wie man es angesichts der Beschäftigung mit ihnen denken könnte. Ein großer Unterschied ist aber, dass die Klimaschützer etwas fordern, wozu sich die Regierung bereits selbst verpflichtet hat. Damals gab es dagegen eine harte Frontstellung, eine riesige Kluft. Gleichwohl gibt es auch heute eine Polarisierung - zum rechtspopulistischen, rechtsradikalen Lager, das den Klimaschutz rundheraus ablehnt. Das ist eigentlich die neue zentrale Frontstellung.
Sie sagen, dass Aktivisten und Regierung das Gleiche wollen, aber sind es bei der älteren Generation von Politikern nicht eher Lippenbekenntnisse, wenn es um den Klimaschutz geht? Ist das nicht das Problem?
Das ist das Problem, wenn wir die Mehrheit der Bevölkerung betrachten. Die Mehrheit unterstützt verbal den Klimaschutz. Aber die Mehrheit zuckt zurück, wenn es um konkrete Maßnahmen geht, die den eigenen Lebensstil einschränken könnten. Diese Kluft bleibt. Aber ein Stück weit Hoffnung macht mir, dass vor allem junge Leute bereit sind, ihren Lebensstil zu ändern. Ein großes Auto ist für viele kein Statussymbol mehr. Aber auch mit Blick auf die junge Generation muss man vermutlich von einer Minderheit sprechen. Es gab zwar einen Politisierungsschub, insbesondere durch Fridays For Future. Der hat aber nie die gesamte jüngere Generation erfasst.
An diesem Freitag soll es nun also wieder eine große Protestveranstaltung geben - einen "globalen Klimastreik". Ist der überhaupt global?
Nein, das ist er nicht. Aber er ist international, weil in vielen anderen Ländern auch Proteste stattfinden. Die sind aber in der Regel sehr klein. Oft sind das nur Gruppen in Großstädten, die an die internationale Kommunikation angeschlossen sind und vielleicht auch Englisch sprechen. Aber es ist nicht so, dass die halbe Welt aufstehen würde. Ich finde auch die Bezeichnung "Klimastreik" unangemessen. Es ist überhaupt kein Streik, es ist eine international koordinierte Demonstration.
In Deutschland ist der Klimaschutz in der politischen Mitte angekommen, auch wenn Sie weiter Protest für notwendig halten. Aber liegt die größere Aufgabe von Fridays For Future nicht im Rest der Welt?
Ja, in der Tat. Man muss aber auch anerkennen, dass es in vielen anderen Ländern andere Prioritäten gibt. Wenn die eigenen Kinder hungern, wenn man von Krankheiten bedroht wird, wenn man in einem repressiven politischen System lebt, liegt der Klimaschutz weit hinten in der Rangordnung der Probleme. Das darf man den Leuten nicht anlasten. Wir würden wahrscheinlich alle so handeln.
Mit Dieter Rucht sprach Volker Petersen