Obama verhandelt in HannoverDie vier großen Probleme bei TTIP
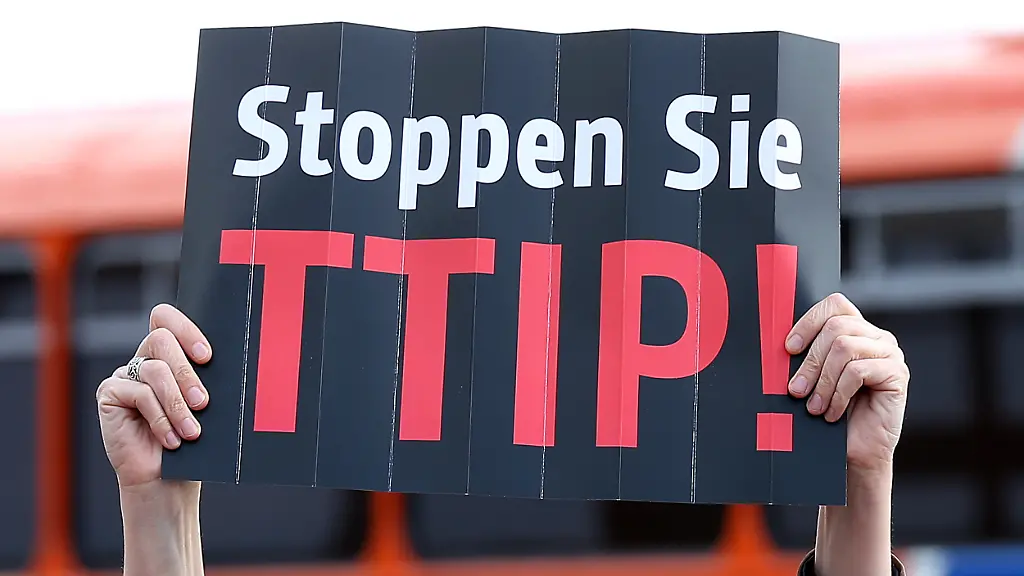
Noch hat kaum jemand das vorläufige TTIP-Abkommen zu Gesicht bekommen. Trotzdem ist der Protest dagegen gut begründet.
Sigmar Gabriel hat sich noch nie dafür ausgesprochen, das TTIP-Abkommen zu ratifizieren. Trotzdem streitet sich der Bundeswirtschaftsminister oft und leidenschaftlich mit den Gegnern dieses Vertrages. Sein Argument: Erst wenn TTIP fertig ausgehandelt ist, kann man es bewerten und sich dafür oder dagegen entscheiden. Das klingt einleuchtend und lange Zeit hat er damit viele Kritiker ruhig gestellt. Doch TTIP wird seit fast drei Jahren verhandelt, seit zwei Jahren gibt es Proteste dagegen, bis Ende 2015 hätten die Eckpunkte feststehen sollen. Die EU kann die Verhandlungstexte vor ihren Bürgern verstecken, aber sie kann den Bürgern nicht verbieten, über das Abkommen zu diskutieren.
Weil die Bürger Zeit genug hatten, ist die Debatte über TTIP praktisch schon abgeschlossen, bevor es fertig ist. 17 Prozent der Deutschen halten das Abkommen für eine gute Sache, etwa doppelt so viele halten es für schlecht. Im vergangenen Herbst demonstrierten über 100.000 Menschen in Berlin. An diesem Samstag gibt es in Hannover eine weitere Großdemo, wenn US-Präsident Barack Obama dort mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und weiteren EU-Regierungschefs zusammenkommt.
Der Protest entzündete sich ursprünglich aus Vorbehalten gegen einheitliche Lebensmittelstandards. Mittlerweile sind die Sorgen viel massiver und wesentlich besser begründet – ganz ohne dass die Details des Abkommens bekannt wären.
Problem 1: Schiedsgerichte. Mittlerweile hat sich herumgesprochen, dass es bei TTIP nicht nur um gleichfarbige Blinker und die Vermeidung doppelter Betriebskontrollen geht, sondern dass mit den gemeinsamen Handelsstandards auch ein Investitionsschutzabkommen vereinbart werden soll.
Von diesen Abkommen gibt es hunderte. Ursprünglich waren die dazu gedacht, Investitionen von westlichen Konzernen in Entwicklungsländern abzusichern. Die Investoren hatten Angst davor, von undemokratischen Regimen enteignet zu werden. Der Investitionsschutz sollte sie davor bewahren. Die Konzerne wollten sich schlicht nicht darauf verlassen, dass sie von einem fremden Gericht fair behandelt werden. Im Laufe der Jahrzehnte hat sich daraus eine parallele Justiz entwickelt, bestehend aus privaten Gerichten, die meist nur für einen Fall zusammenkommen und deren Richter im nächsten Fall wieder einen Staat oder einen Konzern vertreten können. Die Schiedsgerichte sind intransparent, korruptionsanfällig und nicht demokratisch legitimiert.
Durch TTIP soll nun ein Investitionsabkommen zwischen der EU und den USA geschlossen werden. Wenn sich ein US-Konzern in Deutschland zu Unrecht benachteiligt sieht, könnte er die Bundesregierung vor einem Schiedsgericht verklagen. Die Sorge der TTIP-Gegner ist, dass Staaten von kaum kontrollierbaren Schiedsgerichten zu Milliardenzahlungen verurteilt werden. Oder, noch schlimmer, dass sie aus Angst vor solchen Urteilen neue Regulierungen und Umweltvorschriften gar nicht erst erlassen.
Problem 2: Undemokratisch gesetzte Standards. Oft ist die Rede davon, Europa müsse sich durch TTIP an US-Standards anpassen, was Lebensmittel- und Gesundheitsvorschriften angeht. Das bestreiten beide Seiten vehement. Nachprüfbar ist es noch nicht.
Doch in Zukunft könnte es wesentlich schwieriger sein, neue Standards einzuführen – und zwar nicht nur wegen der Schiedsgerichte. Wenn etwa ein neues, möglicherweise gesundheitsgefährdendes Lebensmittel auf den Markt kommt, könnte die EU nicht mehr alleine über ein Verbot entscheiden, so die Befürchtung. Stattdessen müsste ein regulatorischer Rat entscheiden – ein neues Gremium mit Vertretern beider Seiten. Weil in einen solchen Prozess immer auch Vertreter der betroffenen Unternehmen einbezogen werden, könnten sie von Anfang an Einfluss auf den Prozess nehmen. Für nationale Politiker wäre es schwer, ein solches Gremium zu steuern.
Problem 3: Ungleichheit durch freien Handel. Wenn Staaten miteinander Handel treiben, dann steigt in der Regel die Wohlfahrt auf beiden Seiten. So sagt es die ökonomische Theorie und die These lässt sich leicht erklären: Angenommen, die USA bauen gute Computer und Deutschland baut gute Maschinen. Würde es keinen Handel geben, müssten die USA ihre schlechten Maschinen benutzen und Deutschland seine schlechten Computer. Je einfacher der Handel ist, desto besser und günstiger können die Menschen auf die Produkte des jeweils anderen Landes zugreifen. Dadurch fallen zwar Arbeitsplätze in der amerikanischen Maschinenproduktion und in der deutschen Computerproduktion weg, doch im jeweils anderen Sektor entstehen neue und bessere Jobs.
Dieser Effekt wird von kaum einem Wirtschaftswissenschaftler bestritten, doch mehr und mehr weisen die Fachleute darauf hin, dass der freie Handel auch Verlierer produziert. Denn die Jobs, die entstehen, sind andere als die, die wegfallen. So könnte es zum Beispiel sein, dass durch den Freihandel mit den USA Akademiker höhere Löhne verlangen können und Arbeiter gleichzeitig ihre Jobs verlieren.
Nach Ansicht der Kritiker müsste TTIP darum auch mit einer Umverteilung zwischen den sozialen Schichten einhergehen. Davon ist bislang aber nicht die Rede.
Problem 4: Mangelnde Transparenz. Sollten die TTIP-Verhandlungen erfolgreich sein, wird der Vertragstext veröffentlicht, bevor ihn die Parlamente beschließen. Im Prinzip kann sich also dann jeder informieren und sich entscheiden, ob er das Projekt gutheißt oder nicht. Doch die Parlamente können dann nur noch mit Ja oder mit Nein stimmen. Einzelne Passagen zu ändern, wäre sehr aufwändig. Darum weckt die Tatsache, dass auch bereits ausgehandelte Texte geheim gehalten werden, Misstrauen. In Deutschland können nur Bundestagsabgeordnete die Schriftstücke einsehen, sie dürfen nicht einmal ihre engsten Mitarbeiter in den Lesesaal in der US-Botschaft mitnehmen und auch nicht darüber sprechen, was sie gelesen haben. Soll eine informierte Debatte über TTIP verhindert werden?
Die EU und die USA hätten es auch anders angehen können. Sie hätten TTIP in viele kleine Teile aufspalten und diese Teile getrennt verhandeln können. Dann hätten die Staaten die Möglichkeit gehabt, etwa dem Abbau der Zölle zuzustimmen und die Einführung von Schiedsgerichten abzulehnen. Es gibt keinen schlüssigen Grund, dass beides ein Paket bilden muss.
Nun aber steuert TTIP in eine Richtung, in der auch das Urheberrechtsabkommen Acta verschwand: Nach langer, stiller Fachdebatte entdeckten die Bürger das Thema, fühlten sich überrumpelt und mobilisierten erfolgreich gegen den gesamten Vertrag. Die Politiker werden sich darum gut überlegen, ob sie den fertigen TTIP-Vertrag überhaupt zur Abstimmung stellen.