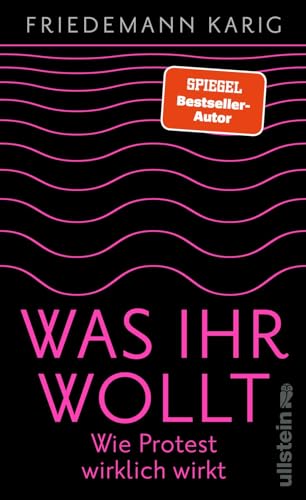Karig über Demonstrationskultur"Deutsche verstehen egoistische Proteste besser"

Friedemann Karig hat eine Art Kochbuch für Proteste geschrieben. Im Interview mit ntv.de erklärt der Autor, woher die deutsche Protest-Skepsis kommt, was niederländische Klimaaktivisten anders machen - und warum die Bauern hierzulande auf größeres Verständnis stoßen als die Letzte Generation.
In der Corona-Pandemie merkt Friedemann Karig, dass Protestieren viel mehr bewirkt, als er - und die meisten Menschen - denken. Sein neues Buch ist daher, so die eigene Beschreibung, eine Art Kochrezept für Proteste. Im Interview mit ntv.de erklärt der Autor, woher die deutsche Protest-Skepsis kommt, was niederländische Klimaaktivisten anders machen - und warum die Bauernproteste hierzulande auf größeres Verständnis stoßen als die Letzte Generation.
ntv.de: In Ihrem Buch schreiben Sie von einem Ihrer Tagebucheinträge, in dem es heißt: "Das ist vielleicht die sinnvollste Zeit meines Lebens." Das war 2020, kurz nach Beginn der Corona-Pandemie. Jetzt, vier Jahre später, erscheint ihr Buch über Proteste. Wie hängt beides zusammen?
Friedemann Karig: Der schlimme Zustand damals hat mich aus meiner bequemen Position am Spielfeldrand herausgezwungen. Es gab eine große Unsicherheit, viele Menschen starben, da wollte ich helfen. Allerdings war ich bis dahin nur selten bei Protesten. Wie viele Menschen in westlichen Ländern habe ich dieses Spiel lieber anderen überlassen. In der Pandemie, als die Normalität für uns alle aufgebrochen war, habe ich verstanden, dass Protest sehr wohl Einfluss hat. Vor allem aber habe ich erkannt, dass Protestieren gar keine so ernste, wütende oder verkopfte Sache sein muss. Im Gegenteil: Protest macht glücklich. Sich mit Leuten zusammentun, von etwas überzeugt sein und sich dafür einsetzen, wirkt nicht nur positiv nach außen, sondern auch nach innen.
Wie passt das mit der großen Zurückhaltung hierzulande in den vergangenen Jahrzehnten zusammen? Immerhin hält sich der Ruf der "protestfaulen" Deutschen hartnäckig.
Ich glaube, protestieren ist wie Sport machen: Man muss erst einmal den inneren Schweinehund überwinden. Die meisten von uns haben in der Schule oder zu Hause nicht gelernt, dass sie etwas bewegen können. Man muss es also erst einmal schaffen, die Beweislast im eigenen Kopf umzudrehen: Statt den zehnten Grund zu finden, mich nicht zu engagieren, muss mir die Frage in den Kopf schießen, was mir eigentlich das Recht gibt, mich rauszuhalten? Wir sind uns wahrscheinlich alle einig, dass viele Dinge nicht gut laufen. Warum denke ich, dass ich ein Recht darauf habe, nur dabei zuzuschauen und nichts zu tun?
Nun könnte eine gewisse Protest-Skepsis in Deutschland auch historische Gründe haben. Sie schreiben von einem Misstrauen der Deutschen gegenüber Ausbrüchen politischer Energie.
Der Nationalsozialismus war eine funkensprühende Revolution, von der sich viele Deutsche eine bessere Zukunft erhofft haben - so hat es Thomas Mann mal formuliert. Ich glaube schon, dass uns das noch tief in den Knochen steckt und wir in Deutschland erst einmal misstrauisch auf jede Form von Zusammenrottung und Massendynamik schauen, zumal diese ja auch schnell gewaltvoll werden können. Das ist auch richtig so. Wir sollten nicht anfangen, völlig kritiklos auf die Straße zu rennen und uns hinter jedem Banner, das gehisst wird, unkritisch zu versammeln. Allerdings haben wir eben die vielen Krisen, vom Klimawandel bis hin zum Antifaschismus, die wir ohne das Begreifen einer eigenen Verantwortung und ohne starke zivilgesellschaftliche Allianzen nicht schaffen werden.
2024 ist das große Demonstrationsjahr - ob für das Klima, gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus oder bei den Bauernprotesten. Warum ist der Protest-Knoten jetzt geplatzt?
Ich würde jetzt gerne sagen: das können Sie in meinem Buch nachlesen. Aber die Wahrheit ist: Ich habe das, auch nach jahrelanger Recherche, nicht kommen sehen. Ich habe aus den USA auf dieses Deutschland geschaut, das ich kaum wiedererkannt habe. Trotzdem gibt es Parallelen der aktuellen Entwicklung zu vielen historischen Protestbewegungen: Eine kleine Gruppe kann Jahre, manchmal Jahrzehnte, auf einen Missstand hinweisen, beispielsweise die AfD und den Rechtsextremismus. Trotzdem braucht es oft einen letzten Faktor, der das Ganze in die Mobilisierung bringt, hier also die "Correctiv"-Recherche.
Sie schreiben auch, dass Minderheiten ausreichen, um Großes zu bewirken. Das klingt für mich widersprüchlich: Geht es bei Protesten nicht gerade darum, die Masse zu versammeln, um gegenüber der Politik größtmöglichen Druck aufzubauen?
Ja, es braucht die Masse an Unterstützerinnen und Unterstützern. Allerdings muss die Masse nicht unbedingt aktiv werden. Ein sehr gutes Beispiel kommt aus den Niederlanden: Dort wollten die Aktivisten von Exctinction Rebellion das Parlament dazu bringen, über fossile Subventionen abzustimmen. Im ersten Schritt haben sie der Bevölkerung klargemacht, dass die bisherigen Zahlen, die die Regierung geliefert hat, manipuliert waren. Im vergangenen September haben sie dann angefangen, immer wieder die gleiche Straße in Den Haag zwischen Klimaministerium und Parlament zu blockieren. Die Aktivisten wurden zu hunderten verhaftet und saßen trotzdem jeden Tag wieder auf dieser Straße. Um die Geschichte abzukürzen: Das niederländische Parlament hat mittlerweile tatsächlich über fossile Subventionen abgestimmt und sich für ein Ende davon ausgesprochen. Und jetzt raten Sie mal, wie viele Menschen es gebraucht hat, um das durchzusetzen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich Hunderttausende auf eine Schnellstraße gesetzt haben.
Es waren gerade einmal 25.000 Menschen. Aber diese 25.000 Menschen hatten einen Plan und waren bereit, ein gewisses Risiko einzugehen. Entscheidend war zum einen, dass sie gut organisiert waren. Entscheidend war aber vor allem, dass sie die große Mehrheit der Bevölkerung hinter sich hatten.
Das heißt, die Niederländerinnen und Niederländer haben die Blockade befürwortet?
Nein, im Gegenteil. Gerade einmal um die 13 Prozent waren für diese Art des Protests. Das Blockieren fanden die allermeisten Niederländerinnen und Niederländer nicht gut. Anders war es bei dem Anliegen: Auf dem Höhepunkt sprachen sich 75 Prozent gegen fossile Subventionen aus. Das zeigt, dass man viel weniger aktive Menschen braucht, als man denkt. Mit diesen wenigen Leuten muss man dann aber hartnäckig sein und für das Richtige kämpfen.
Die Ausgangssituation gleicht derer in Deutschland mit der Letzten Generation: Die Unterstützung für das Festkleben war zuletzt verschwindend gering, mehr Klimaschutzmaßnahmen halten jedoch viele für sinnvoll. Trotzdem hat sich keine einzige Forderung der Letzten Generation durchgesetzt, weder jene nach einem Essen-retten-Gesetz noch die nach einem dauerhaften Neun-Euro-Ticket. Warum klappt hier nicht, was in den Niederlanden funktioniert hat?
In der langen Antwort gibt es durchaus viele kleine Unterschiede zwischen dem niederländischen Protest und jenem der Letzten Generation hierzulande. In den Niederlanden wurde für den Protest etwa immer wieder der gleiche - symbolträchtige - Ort ausgesucht. Es wurde sozusagen der Fluss zwischen Exekutive und Legislative, also denen, die es verbockt haben und denen, die es lösen sollen, unterbrochen. Die Letzte Generation hat verschiedene Orte in der Stadt und vor allem die Bürgerinnen und Bürger blockiert. Zudem war es in den Niederlanden ein echter David-gegen-Goliath-Moment, denn mit ihrem Anliegen haben die Aktivisten nicht nur die Politik, sondern auch die riesige Öl-Lobby angegriffen. Das zieht die Gesellschaft natürlich anders mit, da man immer eher für den Underdog ist. Schließlich hat es die Niederländer viel mehr aufgebracht, dass die Protestierenden massenhaft verhaftet wurden, obwohl sie für eine gerechte Sache kämpfen. Im Gegensatz dazu hat es die Letzte Generation hier nicht geschafft, die Menschen in der demokratischen Frage "Was darf Protest?" auf ihre Seite zu ziehen.
Wie lautet die kurze Antwort?
Man hat es hierzulande noch nicht richtig ausprobiert. Wir hatten diesen Fall in Deutschland noch nicht: Eine Gruppe protestiert für eine ganz klare politische Maßnahme, die jedes Kind versteht und bei der es vorher auch eine Informationskampagne, vielleicht sogar einen Skandal auf politischer Seite gab. Allerdings weiß ich, dass die deutschen Aktivistinnen und Aktivisten genau zugeschaut haben und in den Startlöchern stehen.
Sie betonen in Ihrem Buch, dass vor allem friedlicher Protest erfolgreich sei. Die Letzte Generation hat zwar jüngst einen Strategiewechsel angekündigt, setzt aber weiterhin auf zivilen Ungehorsam, also Regelbrüche. Ist das für Sie friedlich?
Ja, hundertprozentig. Bisher hat die Gruppe zwar in die Freiheitsrechte von Autofahrern und in den Straßenverkehr eingegriffen. Allerdings ist der Protest immer gewaltfrei und demokratisch geblieben. Er richtet sich ja gerade an eine demokratisch gewählte Regierung, zweifelt deren Legitimität also nicht an oder will sie gar absetzen. Die Gruppe hat auch die juristischen Konsequenzen des Rechtsstaats anerkannt und hat sich ihnen nicht entzogen. Das ist der Unterschied zu den sogenannten Bauernprotesten, bei denen Misthaufen auf Schnellstraßen abgeladen werden und man riskiert, dass dort Menschen reinfahren und sich Unfälle ereignen. Dabei setzt man Menschenleben aufs Spiel. Hier verläuft die Grenze zwischen friedlich und gewaltvoll.
Und trotzdem lag die Unterstützung aus der Bevölkerung für die Bauernproteste weitaus höher als jene für die Letzte Generation.
Das Beispiel aus den Niederlanden zeigt, dass die Unterstützung für die Protestform eigentlich egal ist. Es geht um das Anliegen. Das ist bei den Gruppen höchst unterschiedlich. Bei den Bauern geht es um Partikularinteressen. Sie protestieren gegen die Abschaffung von Subventionen, von denen sie profitieren. Dass es sich um systemrelevante Berufe handelt und wir sicherstellen müssen, dass die deutschen Höfe funktionieren, ist selbstverständlich. Trotzdem ist ihr Protestgrund ein egoistischer, am Ende geht es um Geld. Die Letzte Generation protestiert für Klimaschutz und Maßnahmen, die alle betreffen. Anhand dieses Vergleichs können wir feststellen: Deutsche verstehen egoistische Proteste besser als Proteste für das Gemeinwohl. Wenn jemand für alle demonstriert, weckt das Misstrauen, da wird gleich eine versteckte Agenda vermutet. Dabei würde man sich wünschen, dass es andersherum ist.
Sie beschreiben in Ihrem Buch viele große, erfolgreiche Protestbewegungen wie die schwarze Bürgerrechtsbewegung in den USA oder den Euromaidan in der Ukraine. Haben die aktuellen Massendemonstrationen gegen Rechtsextremismus in Deutschland Potenzial für einen ähnlichen Erfolg?
Sie müssen. Wir müssen alles in die Waagschale werfen, um den Rechtsextremismus zu bekämpfen und zu verhindern, dass die AfD an Macht gewinnt. Wenn wir das nicht schaffen, wird sie es uns in Zukunft immer schwerer machen, die Demokratie zu schützen. Also müssen wir die demokratischen Mittel jetzt nutzen - und Proteste sind ein besonderes wichtiges. Denn Studien zeigen, dass Massenproteste gegen Rechtsextreme wirklich wirken, es sie Stimmen kostet, wenn man gegen sie demonstriert. Deswegen ist es so wichtig, dass wir diese klaffende Lücke in unserer Bildung über Proteste und Demonstrationen schließen. Alle sollen wissen, wie man Menschen mobilisiert, was legitimer Protest ist und wann es gefährlich wird. Dieses kleine Einmaleins dieses demokratischen Instruments sollten wir in diesen Zeiten alle kennen.
Mit Friedemann Karig sprach Sarah Platz