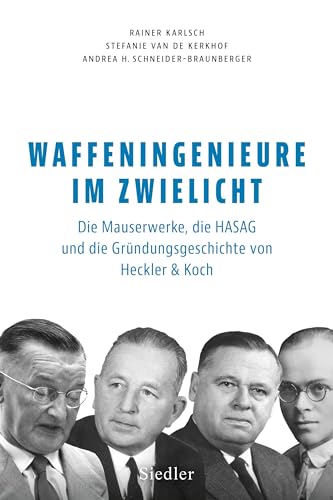Vergangenheit der WaffenschmiedeWaren die Gründer von Heckler & Koch NS-Profiteure?

2020 werfen Medien den Gründern des Waffenherstellers Heckler & Koch eine Verwicklung in das NS-Zwangsarbeitssystem vor. Daraufhin untersucht die Gesellschaft für Unternehmensgeschichte die Vergangenheit der Gründer. Wie können sie kurz nach der Stunde Null ein Rüstungsunternehmen aufbauen? Die nun veröffentlichte Studie gibt Aufschluss.
Wenige Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wird das Unternehmen Heckler & Koch gegründet. Heute ist das Unternehmen ein großer Waffenhersteller aus Deutschland und weltweit bekannt. Die NS-Vergangenheit der Gründer bleibt lange ein blinder Fleck der Unternehmensgeschichte. 2020 werfen Medienberichte den Gründern die Verwicklung in das NS-Zwangsarbeitssystem vor. Wie konnten sie kurz nach der Stunde Null ein Rüstungsunternehmen aufbauen? Waren sie dazu nur in der Lage, weil sie vom NS-System profitiert hatten? Dieser und anderen Fragen geht die nun veröffentlichte Studie "Waffenschmiede im Zwielicht" der Gesellschaft für Unternehmensgeschichte auf den Grund. Im Interview mit ntv.de spricht die Historikerin Andrea Schneider-Braunberger über ihre Forschung.
ntv.de: Was sind die Ergebnisse Ihrer Forschung?
Andrea Schneider-Braunberger: Gründer Edmund Heckler war von 1934 bis 1945 Waffen-Ingenieur beim Metallwarenunternehmen Hugo Schneider AG (HASAG), das während des Zweiten Weltkrieges zum führenden Munitionsproduzenten im "Dritten Reich" wurde. In der Endphase des Krieges 1944 mobilisierte die HASAG alle Kräfte zum Hochfahren der Panzerfaustproduktion. Dafür wurden Tausende überwiegend weibliche Häftlinge aus Konzentrationslagern an den verschiedenen Standorten der HASAG eingesetzt. 1940 wurde Oberingenieur Heckler als Leiter eines kleineren Zweigwerkes in Taucha nahe Leipzig eingesetzt. Unmittelbar zuvor war er der NSDAP beigetreten. In Taucha wurden hauptsächlich Kartuschen produziert, für die Wehrmacht, die Luftwaffe und den italienischen Verbündeten. In diesem HASAG-Werk wurden neben deutschen Arbeiterinnen und Arbeitern mehr als 1000 Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, vor allem aus Polen, tätig. Für ihren Einsatz trug Heckler in seiner Funktion als Betriebsleiter die Verantwortung. Aber unter seiner Leitung waren keine Häftlinge aus Konzentrationslagern eingesetzt.
Sie unterscheiden Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge. Worin genau liegt da ein Unterschied?
Historiker unterscheiden drei Gruppen von Zwangsarbeitern: die Kriegsgefangenen, zivile Zwangsarbeiter und Häftlinge aus den Konzentrationslagern. Die KZ-Häftlinge, vor allem Juden und politische NS-Verfolgte, wurden auch bei der Arbeit außerhalb der KZs durch die SS bewacht. Im Verhältnis zu den ersten beiden Gruppen traf es die KZ-Häftlinge am härtesten, weil sie in der NS-Rassenhierarchie an unterster Stelle standen. Sie bekamen wenig zu essen und wurden in allen möglichen denkbaren oder undenkbaren Szenarien misshandelt oder ermordet. Sie sollten so lange ausgezehrt werden, bis sie tatsächlich vor Erschöpfung einfach starben. Wenn man in der Hierarchie eines Unternehmens für diese Menschen verantwortlich war, bedeutet das, für Gräueltaten, Misshandlung und Tod dieser Menschen direkt verantwortlich zu sein.
Und welche Verantwortung hatte Heckler nun für Zwangsarbeiter?
Die konkreten Umstände des Einsatzes von Zwangsarbeitern waren sehr unterschiedlich. Die schlimmsten Verbrechen gegen die Menschlichkeit fanden in den HASAG-Werken im besetzten Polen statt. Ab 1941 mussten dort vor allem Jüdinnen und Juden unter unsäglichen Bedingungen schuften. Sie entgingen damit ihrer sofortigen Ermordung, allerdings oft nur für einige Monate. Rund 14.000 Jüdinnen und Juden sind einer Schätzung zufolge in den HASAG-Werken im besetzten Polen an Entkräftung und Krankheiten gestorben oder sie wurden Opfer von Erschießungen durch Werkschutz, SS und einzelne HASAG-Angehörige. Heckler blieb ein Einsatz in den HASAG-Werken in "Generalgouvernement" allerdings erspart. In dem von ihm geleiteten Werk "Taucha I" kam es nicht zum Einsatz von KZ-Häftlingen. Dies geschah im Rahmen der Panzerfaustproduktion im gegenüberliegenden Werk "Taucha II" ab Oktober 1944. "Taucha II" wurde von Ingenieur Friedrich Tanzen geleitet. Das festzustellen bedeutet nicht, die verschiedenen Opfergruppen gegeneinander auszuspielen, zumal in der Endphase des Krieges die rassenideologisch verordnete Trennung zwischen den verschiedenen Gruppen von Zwangsarbeitern nicht mehr in Gänze funktionierte. Insofern nehmen unsere Forschungsergebnisse Heckler nicht aus der Verantwortung. Sie sortieren den Gründer etwas präziser ein, sodass sie die ursprünglichen Vorwürfe relativieren.
Inwiefern relativieren?
Die ursprünglichen Vorwürfe machten Heckler fälschlicherweise zum zweiten Mann hinter SS-Sturmführer Paul Budin, einem fanatischen NS-Anhänger. Budin war seit 1931 Vorstand und später Generaldirektor der HASAG. Er scharte um sich einen Kreis von SS-Offizieren und besonders regimetreuen Managern. Zu dieser Gruppe gehörte der politisch desinteressierte Heckler nicht. Er war nicht Mitglied des Vorstands der HASAG, sondern ist der zweiten Leitungsebene, die insgesamt 28 Prokuristen umfasste, zuzuordnen. Als Leiter eines Zweigwerks war er an die Weisungen des Vorstands gebunden. Ihm in technischer Hinsicht unmittelbar vorgesetzt war Max Liebergeld, dem ab 1942 die gesamte Kartuschenproduktion an allen HASAG-Standorten unterstand. Dennoch gibt es an dem Befund, dass Heckler während des Nationalsozialismus für ein furchtbares Unternehmen gearbeitet hat, das für schreckliche Verbrechen verantwortlich war, nichts zu rütteln. Heckler hat mit Sicherheit auch das eine oder andere gesehen und wahrgenommen, aber er gehörte in der Hierarchie des Unternehmens HASAG nicht zu den Hauptverantwortlichen.
Und was sind Ihre Ergebnisse in Bezug auf die anderen Gründer?
Auch in den Mauser-Werken in Oberndorf am Neckar, wo Alexius Seidel und Theodor Koch in der NS-Zeit arbeiteten, gab es Zwangsarbeiter. Während des Zweiten Weltkriegs produzierte der traditionsreiche Gewehrfabrikant Mauser in Oberndorf Kleinwaffen über MG bis zur Flak und dazugehöriger Munition. Als Ingenieur und Konstrukteur in einer kleinen Forschungsabteilung entwickelte Seidel unter anderem die HSc-Pistole und die "Volkssturm-Pistole". Wir konnten nicht rekonstruieren, ob Seidel für Zwangsarbeiter verantwortlich war. Es ist aber sehr unwahrscheinlich. Ganz im Unterschied zu Koch, der eine übergeordnete Führungsfunktion bei Mauser innehatte. Koch war seit 1944 Oberingenieur und trug als Abteilungsleiter eine größere Verantwortung. Deshalb gehen wir davon aus, dass Koch für Zwangsarbeiter verantwortlich war, konnten es aber nicht genau bestimmen.
Woran machen Sie diesen Befund fest?
Wir haben in den Quellen keinerlei Anzeigen, Vorwürfe oder Beschwerden vonseiten ehemaliger Zwangsarbeiter oder Widerstandskämpfer dafür gefunden, dass die Gründer von Heckler & Koch sich in irgendeiner Form an Zwangsarbeitern vergriffen oder Repressionen angeordnet hätten. Im Fall von Heckler kann man das insofern schlussfolgern, weil es zwei größere Nachkriegsprozesse in Sachsen und später noch Dutzende weitere Prozesse in mehreren Ländern gegen HASAG-Mitarbeiter gegeben hat, in denen zahlreiche ehemalige Zwangsarbeiter und HASAG-Mitarbeiter ausgesagt haben. Wir haben die Gerichtsprotokolle gesichtet, Tausende von Seiten - der Name Heckler fällt kein einziges Mal.
Also waren die Gründer schon in das System Zwangsarbeit verwickelt?
Weder Heckler bei der HASAG in Leipzig noch Seidel und Koch in Oberndorf haben Zwangsarbeiter umgebracht oder misshandelt. Allerdings war die Brutalität des Zwangsarbeitssystems in Oberndorf noch offensichtlicher als bei der HASAG in der großen Stadt Leipzig, wo die polnischen Werke weit weg liegen: Die Mauser-Werke waren im kleinen Oberndorf das einzige große Unternehmen, in dem sehr viele Einwohner beschäftigt waren. Natürlich waren die Oberndorfer Mitwisser. Die Zwangsarbeiter wurden jeden Morgen durch den kleinen Ort transportiert. Es fanden auch Exekutionen der Zwangsarbeiter im öffentlichen Raum statt. Die Oberndorfer wussten von den Verbrechen und haben eben nicht darauf reagiert. Das ist ein Befund unserer Studie.
Aber die drei Ingenieure waren dennoch Teil des NS-Systems …
Alle drei waren in Rüstungsunternehmen tätig, damit waren sie hochrelevant, man nannte das damals "unabkömmlich" für die Kriegswirtschaft. Jeder, der in einem Rüstungsbetrieb tätig ist, dem ist auch klar, was er da tut. Keiner von ihnen hat sich in irgendeiner Hinsicht distanziert oder vom NS-System abgekehrt. Im Gegensatz zu anderen Unternehmern, die an der einen oder anderen Stelle nicht einverstanden mit dem NS-System waren, haben sich Heckler, Koch und Seidel widerspruchslos in den Nationalsozialismus eingefügt. Insofern waren sie also sehr gut integriert in das NS-System. Sie trugen dazu bei, dass die Rüstungswirtschaft bis zuletzt funktionierte.
Die Gründer waren also Opportunisten. Aber inwiefern haben sie profitiert?
Profitiert haben sie alle drei. Sie machten Karriere, konnten in den Firmenhierarchien aufsteigen und ihre materielle Situation verbessern. In unserer Studie haben wir die Gehaltserhöhungen aufgelistet, daran sieht man eine deutliche Kurve nach oben. Trotzdem sind sie keine Kriegsgewinnler, weil sie nach dem Krieg fast alles verloren haben. In der Nachkriegszeit leben sie in bescheidenen Verhältnissen.
Und was ist mit der Frage nach der Kontinuität?
Häufig wird irrtümlicherweise angenommen, Heckler & Koch sei ein Nachfolgeunternehmen der in Oberndorf ansässigen Mauser-Werke. Das Unternehmen war aber eine Neugründung. Im institutionellen, unternehmerischen Sinne gibt es keine Kontinuität. Die vermeintliche Ausrichtung als Waffenhersteller war nicht die Gründungsidee. Wir finden aber in den Menschen eine personelle Kontinuität zu den Mitarbeitern der Mauser-Werke. Die Gründer kannten sich bereits aus Schulzeiten. Nach dem Krieg versuchten sie gemeinsam, eine neue wirtschaftliche Existenz mit der Konstruktion und dem Bau von Nähmaschinenteilen aufzubauen. Dafür brauchten sie Fachkräfte, die in der Präzisionsarbeit geschult waren. Deshalb stellten sie zahlreiche Mitarbeiter ein, die zuvor bei den Mauser-Werken in der Waffenfertigung beschäftigt waren. Zudem kauften sie im Rahmen der Demontage der Alliierten einige Maschinen aus den Mauser-Werken ab.
Also basiert die Gründung doch auf einer Kontinuität?
Im Zuge der Demontage der Mauser-Werke waren viele Oberndorfer nach 1945 arbeitslos. Auch Heckler, Koch und Seidel mussten sich in dieser Zeit neu orientieren. Die Menschen schauten nach vorne, sie wollten wieder etwas aufbauen in diesen schwierigen Zeiten. Der Aufbau von Heckler & Koch hat diese Lücke gefüllt. Sowohl die Kommune als auch das Land Baden-Württemberg haben die Gründung gefördert, um Arbeitsplätze zu schaffen. Das ist eine Kontinuität mit Blick auf die Arbeitskräfte, aber doch mit einem sehr deutlichen Bruch mit Blick auf die unternehmerische Konstellation. Das Besondere in dem kleinen Städtchen Oberndorf ist, dass Mitarbeiter der Mauser-Werke und ihre Familien, Jungunternehmer wie Verwaltung alle besonders lange nicht zurückgesehen und in einer vermeintlichen Idylle einfach weitergemacht haben, als wäre nichts gewesen. Das hat ein unglaubliches Beharrungsmoment und wirkt bis heute nach.
Inwiefern steht die Geschichte des Unternehmens stellvertretend für den Umgang der Deutschen mit der NS-Vergangenheit?
Die allermeisten Deutschen sahen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht zurück. Sie wollten dieses Unrecht, diese Verbrechen, dieses Leid vergessen. Verdrängen und Vergessen sind Teil der notwendigen psychischen Resilienz des Menschen - egal, was wir da heute drüber denken mögen. Wir haben dieses unmittelbare Vergessen bundesweit. Zu dem individuellen Selbstschutz kommt ein bewusstes institutionelles Ausradieren, indem Akten und Beweise vernichtet wurden. Es gibt Archive in Deutschland, nicht nur Unternehmensarchive, sondern auch öffentliche Archive, in denen fehlen die Akten der Jahrgänge zwischen 1930 und 1945.
Und wie wurde Heckler & Koch schließlich doch zur Waffenschmiede?
Der erste Vorbereitungsauftrag für zur Herstellung von Sturmgewehren kam 1952 aus Spanien vom und für den spanischen Diktator Franco. Dieser Auftrag wurde gefördert durch das Amt Blank, der Vorläufer-Institution des Bundesverteidigungsministeriums. CDU-Politiker Theodor Blank, Leiter der nach ihm benannten Behörde, ließ damals im Auftrag von Bundeskanzler Konrad Adenauer die Optionen prüfen, welche Unternehmen künftig als Waffenproduzenten infrage kämen. Es gab damals nicht viele Firmen, die Waffen herstellen konnten und wollten. Heckler ergriff selbst die Initiative und erklärte, dass Heckler & Koch in der Lage sei, Sturmgewehre, Maschinenpistolen oder Pistolen herzustellen. Die drei Gründer haben sich auf das zurückbesonnen, was sie gut konnten: Waffen bauen. Sie hatten in einer günstigen Konstellation zusammengefunden. Koch war gut im Maschinenbau, Seidel war ein renommierter Waffenkonstrukteur und Heckler war ein wirklich guter Manager. Und auch die Interessen der übrigen Akteure - Spanien, die Bundesrepublik Deutschland, das Land Baden-Württemberg und Oberndorf - begünstigten das Unternehmen. Ohne diese Unterstützung hätte es Heckler & Koch nicht geschafft. So konnte sich Heckler & Koch 1959 im langjährigen Rennen um den ersten großen Auftrag zur Fertigung von Sturmgewehren für die im Zuge der Wiederbewaffnung der BRD neu gegründete Bundeswehr gegen die internationale Konkurrenz der Gewehrhersteller durchsetzen.
Mit Andrea Schneider-Braunberger sprach Rebecca Wegmann