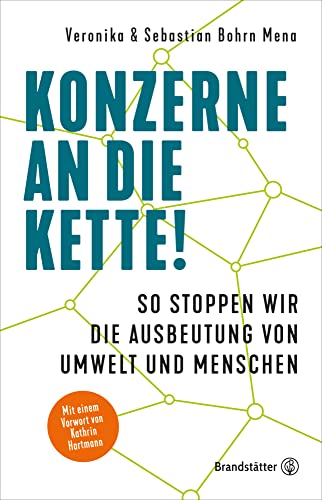Raubbau, Kinderarbeit, Lohnklau"Produktionsweisen sind keine Urgewalt"

Das Lieferketten-Chaos zeigt, wie fragil die globalisierte Industrie ist. Auch prekäre Arbeitsbedingungen sind immer wieder ein Thema. "Corona treibt das Leid der Menschen auf die Spitze", sagt Veronica Bohrn Mena. "Aber Corona birgt auch Vorteile", meint die Expertin für Arbeitsrecht: Konzerne müssen umdenken.
Das Lieferketten-Chaos in der Pandemie zeigt, wie fragil die Industrie ist. Auch prekäre Arbeitsbedingungen, die fester Bestandteil der Globalisierung sind, rücken dabei in den Fokus. "Corona hat das Leid der Menschen auf die Spitze getrieben", sagt die österreichische Expertin für Arbeitsrecht Veronica Bohrn Mena. Corona birgt für sie aber auch Vorteile. Mit dem Virus, einem deutschen Lieferkettengesetz ab 2023 und einer Prozesslawine gegen Großkonzerne kündige sich ein Wandel an. Die Autorin von "Konzerne an die Kette!" hofft auf eine "Lawine", die für mehr Fairness entlang der Lieferketten sowie Fortschritten bei Menschenrechten und Klimaschutz sorgen wird. Konzerne müssten umdenken.
ntv.de: Mit Billig-Produktionsbedingungen am anderen Ende der Lieferketten wird im Westen viel Profit gemacht. Sie haben die dunklen Seiten dieses Systems lange studiert. Das Ergebnis ist Ihr Buch "Konzerne an die Kette!", das Sie gemeinsam mit Ihrem Mann, dem Ökonomen Sebastian Bohrn Mena, geschrieben haben. Der Appell drückt Wut aus. Oder täuscht das?
Veronika Bohrn Mena: Der Titel ist tatsächlich aus einer Frustration heraus entstanden. Ich habe mich viel mit prekär Beschäftigten, die zum Beispiel mit befristeten Verträgen arbeiten, befasst. Bei der Forderung nach Verbesserungen habe ich immer wieder das Argument gehört: Verdienen Ernte-Arbeiter und -Arbeiterinnen beispielsweise nur einen Euro mehr in der Stunde, wird der Wirtschaftsstandort leiden. Das ist ein ewiges Totschlagargument. Wir stecken in einer Negativspirale des Wettbewerbs, alle sollen sich danach richten, dass ein Wirtschaftsstandort nicht leidet. Aber die Menschen, die Beschäftigten und die Umwelt leiden darunter.
Hat ein bestimmtes Ereignis das Fass zum Überlaufen gebracht?
Der Tönnies-Skandal zu Beginn der Pandemie vor zwei Jahren. Überall dort, wo es Schlachtbetriebe mit vielen Arbeitern gab - die furchtbar untergebracht sind-, entstanden große Corona-Cluster. Die Diskussionen drehten sich daraufhin entweder darum, dass Schnitzel teurer werden oder andere Werksverträge abgeschlossen werden müssten. Für uns löst das nicht das Problem. Die Konzerne haben die Lage doch schamlos ausgenutzt. Sie sind die Schuldigen. Sie sind die Nutznießer der Deregulierungsmaßnahmen der letzten 40 Jahre in der EU.
Lieferketten sind in der Pandemie plötzlich ein großes Thema. "Made in Germany" oder "Made in Europe" erleben angeblich ein Comeback. Ist Corona so was wie ein Glücksfall für Sie, weil die Lebens- und Arbeitsbedingungen der prekär Beschäftigten perspektivisch dadurch vielleicht besser werden?
Corona ist tatsächlich von Vorteil. Die Pandemie hat die Abhängigkeit von China und von Rohstoffen aus China gezeigt. Ich glaube aber, das Umdenken bei den Konsumenten und Konsumentinnen hat schon vorher begonnen. Die Pandemie hat das Ganze nur massiv beschleunigt. Krisen wirken immer wie ein Brennglas, Probleme werden größer. Dass ein Apfel aus Chile im Supermarkt in Österreich billiger ist als ein Apfel aus der Steiermark, war schon vorher nicht nachvollziehbar. In der Pandemie wurden Lieferketten dann aber zu einem größeren Problem, weil beispielsweise zu wenige Masken aus China in Deutschland ankamen. Wir haben auch gelernt, dass über den Warenverkehr Krankheiten transportiert werden. Corona verstärkt die Probleme der Globalisierung - macht sie sichtbarer.
Der Tönnies-Skandal war praktisch vor unserer Haustür. Produktionsstandorte in Fernost zu kontrollieren, ist schwieriger. Ab 2023 gilt in Deutschland ein Lieferkettengesetz, das bei Zulieferern für das Einhalten von Menschenrechten und Umweltschutz sorgen soll. Was halten Sie von dem Gesetz?
Ich halte das Gesetz für gut und wichtig, auch wenn es stark abgeschwächt wurde und kein großer Wurf gelungen ist. Meiner Ansicht nach hätten kleinere Unternehmen von Anfang an mehr in die Pflicht genommen werden müssen. Auch grobe Umweltverstöße und klimaschädliches Verhalten sollten anfangs ins Gesetz aufgenommen werden. Aber vor 10 oder 20 Jahren wäre so ein Gesetz nicht einmal denkbar gewesen, obwohl wir damals schon wussten, dass unser Produktionssystem auf schlechteren Arbeitsbedingungen in anderen Ländern basiert. Wir sind heute also einen Schritt weiter. Trotzdem sehe ich ein großes Problem. Es ist doch kurios: Das Gesetz ist im Interesse der Mehrheit aller Menschen, auch im Interesse der Volkswirtschaften - sowohl bei uns im Westen, als auch im globalen Süden. Es ist im Interesse der Natur und des Klimas. Tatsächlich hat es wirklich nur Vorteile …
Aber?
... Es hat Nachteile für die Konzerne, weil es sie einschränkt. Und die Konzerne haben eine starke Lobby, das gilt nicht nur in Deutschland oder Österreich, sondern in ganz Europa. Deshalb verwenden sie auch sehr viel Geld darauf, ihre Interessen durchzusetzen. Genau das sehen wir jetzt in Europa.
Sie sagen, dass Konzerne Europa auf dem Weg zu faireren und nachhaltigeren Lieferketten Steine in den Weg legen?
Der Entwurf für ein europäisches Lieferkettengesetz, der im Mai hätte vorgelegt werden sollen, ist dreimal im internen Kontrollgremium durchgefallen. So etwas ist insgesamt erst viermal passiert, zum Beispiel als es um eine Finanztransaktionssteuer und um ein Transparenzgesetz ging. Das heißt, sobald Konzerne den Eindruck haben, in Europa passiert etwas, das nicht in ihrem Interesse ist, werden diese Gesetze verzögert oder gestoppt. Das ist kein demokratischer Vorgang! Denn wohlgemerkt: Im Parlament gab es vorher eine große Mehrheit, die ein Lieferkettengesetz auf den Weg bringen wollte, das sogar wesentlich strenger war, als die deutsche Variante.
Welche europäischen Länder haben denn neben Deutschland bereits ein Lieferkettengesetz?
Frankreich, die Niederlanden und Großbritannien, das natürlich jetzt nicht mehr zur EU gehört. Österreich kämpft leider noch um so ein Gesetz.
Für Ihr Buch haben Sie viel recherchiert. Ihr Tomaten-Pizza-Beispiel zeigt eindrucksvoll, dass uns das Problem der Ausbeutung in Produktionsprozessen näher ist, als wir denken. Nur den wenigsten ist es aber wohl bewusst …
Das Tomaten-Pizza-Beispiel haben wir genau aus diesem Grund gewählt, weil Lieferketten und das Lieferkettengesetz eine sehr sperrige Angelegenheit sind, es uns aber alle angeht. Deshalb haben wir drei Alltagsgegenstände gewählt, an denen wir alle nicht vorbeikommen. Tiefkühlpizza ist das beliebteste Fertigprodukt. Jeder hat sie schon mal gekauft, aber sich wahrscheinlich wenig dabei gedacht. An der Tomate lässt sich zeigen, dass der Preis für ein Produkt und die Kosten der Erzeugung nicht mehr miteinander in Relation stehen. Wir zahlen nicht dafür, was die Produktion kostet, sondern das, was Handelskonzerne - nicht produzierende Konzerne wohlgemerkt -, für sich rausholen können. Wenn eine Tomate bei uns einen Euro kostet, dann streichen die Handelskonzerne davon 85 Cent ein, 10 Cent landen beim Großhändler in Italien. Von den übrig gebliebenen 10 Cent landen am Ende nur 2 Cent dort, wo die Tomate angebaut wird. Eins ist klar: Dafür kann nicht auf menschengerechte und klimagerechte Weise produziert werden.
In der Pandemie gibt es noch etwas, das so aussieht, als würde in der Globalisierung ein neues Kapitel geschrieben: Menschen, die in prekären Arbeitsverhältnissen gearbeitet und gelebt haben, machen das nicht mehr mit. In Amerika heißt das Phänomen "The Big Quit".
Richtig. In den USA ist die Situation so weit fortgeschritten, dass die Menschen sagen, sie können da nicht mehr mitmachen. Es geht eine große Kündigungswelle - vonseiten der Arbeiter und Arbeiterinnen durchs Land -, sodass es für die Unternehmen schwierig ist, noch Mitarbeiter für die niedrigen Arbeiten zu finden. In Deutschland und Österreich fehlen Pfleger und Pflegerinnen, weil Pflege ein System ist, das darauf basiert, Leistungen von Menschen aus osteuropäischen Ländern billig einzukaufen. Auch in Großbritannien sieht man das Phänomen. Dort bleiben deshalb Supermarktregale leer. Es gibt keine Lkw-Fahrer, weil die polnischen Fahrer nicht mehr nach Großbritannien reisen können und die Briten zu den gleichen Konditionen nicht Lkw fahren. Wir sehen auch, dass Ernten verkommen, weil Feldarbeiter fehlen. Das hätten wir uns alles vor 20 Jahren nicht vorstellen können.
Ist das eine Zeitenwende?
Es ist ein wichtiger Moment. Und das hat damit zu tun, dass Corona das Leid der Menschen auf die Spitze getrieben hat. Corona hat die Bedingungen für Arbeiter so stark verschärft, dass sie jetzt sagen: so weit und nicht weiter. Der Grund ist, dass zu den furchtbaren Arbeitsbedingungen nun noch die gesundheitlichen Gefahren hinzukommen.
Es gibt auch vermehrt Prozesse, die aufhorchen lassen. Den fünf großen Tech-Konzernen wird vorgeworfen, den Tod von Kindern im Kobaltabbau verschuldet zu haben. Welche Bedeutung messen Sie dem bei?
Ich halte die Prozesse für wahnsinnig wichtig. Es gibt Organisationen, die nichts anderes machen, als in verschiedenen Ländern gegen Konzerne zu klagen. Das "European Center for Constitutional Humanrights" beispielsweise, das in Deutschland im vergangenen Jahr Klagen gegen Textilproduzenten wie Hugo Boss eingereicht hat, die ihre Waren in China von uigurischen Zwangsarbeitern produzieren lassen. Von der deutschen Staatsanwaltschaft wurde das nicht weiter verfolgt. Jetzt wird in Frankreich ein Prozess eingeleitet, dort ist das Rechtssystem etwas progressiver. Konzerne sind profitorientiert. In dem Moment, wo es zu heiklen Strafzahlungen, zu persönlichen Konsequenzen für die Geschäftsführung kommt und ein großer Imageschaden entsteht, hat es einen Effekt.
Denken Sie, das deutsche Lieferkettengesetz kann solche Fälle verhindern?
Ab dem Zeitpunkt, ab dem ein deutscher Geschäftsführer haften muss, sofort. Im Bereich der menschenrechtlichen Verbrechen, also Kinderarbeit, moderne Sklaverei und Zwangsarbeit wird es auf jeden Fall zu Verbesserung kommen. Eine Lawine wird ins Rollen kommen. Am Ende des Tages werden Konzerne von Menschen geleitet, die darauf bedacht sind, beruflich keinen Schiffbruch zu erleiden. Das wird die Produktionsweisen ändern. Wir stehen hier nicht vor einer Urgewalt.
Mit Veronika Bohrn Mena sprach Diana Dittmer