Die Macht des UnbewusstenRisikofreude lässt sich vorhersagen
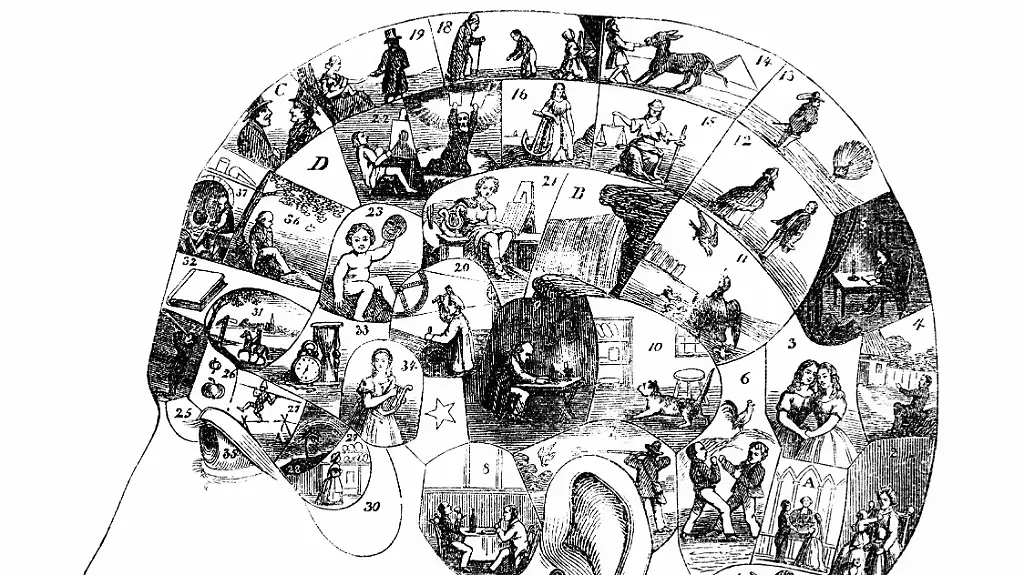
Die Hirnforschung stellt den freien Willen zunehmend infrage. Lange bevor das Bewusstsein überhaupt Notiz davon nimmt, ist im Gehirn die Entscheidung längst gefallen. In einem neuen Experiment beweisen Forscher, dass das auch für die Risikobereitschaft eines Menschen gilt.
Wird ein Mensch ein Risiko wagen oder auf Nummer sicher gehen? Anhand der Hirnaktivität lasse sich eine solche Entscheidung gut vorhersagen, berichten US-Forscher in den "Proceedings" der US-nationalen Akademie der Wissenschaften ("PNAS"). Entscheidend seien Areale, die bei der Vermeidung eines Risikos aktiver seien als beim Beschluss, das Wagnis einzugehen. Das wiederum lasse vermuten, dass Risikofreude auf Fehler in diesem Kontrollsystem zurückgehe.
Die Forscher um Sarah Helfinstein von der University of Texas in Austin hatten mehr als 100 Menschen einen sogenannten BART-Test (Balloon Analogue Risk Task) machen lassen, der häufig zur Analyse kognitiver Prozesse eingesetzt wird. Die Probanden blasen dabei - virtuell am Computer - mit Luftstößen aus einer Pumpe Ballons auf und entscheiden selbst, wie groß sie den Ballon werden lassen. Je größer der jeweilige Ballon, desto besser werden die Teilnehmer entlohnt - allerdings gibt es gar nichts, wenn der Ballon platzt. Bei jedem Pumpstoß haben sie somit die Wahl zwischen sicherem Lohn und dem wachsenden Risiko, leer auszugehen.
Auch im realen Leben eher unvorsichtig
Frühere Studien zeigten, dass Menschen, die im BART-Test riskant entscheiden, auch im realen Leben eher unvorsichtig leben - sie rauchen eher, nehmen mehr Drogen, haben mehr ungeschützten Sex und fahren riskanter.
Die Wissenschaftler ließen nun 108 Männer und Frauen zwischen 21 und 50 Jahren den Test absolvieren und zeichneten dabei mittels funktioneller Magnetresonanztomographie (fMRT) die Hirnaktivität auf. Im Schnitt pumpten die Probanden 18 Ballons auf und stoppten elf Mal rechtzeitig vor dem Platzen. Aus den Daten erstellten die Forscher einen selbstlernenden Algorithmus, mit dem erfasst und bewertet wurde, welche Hirnregionen vor der Entscheidung zum Aussteigen aktiv waren - und welche beim Entschluss zum Weiterpumpen.
Mit Hilfe dieser Klassifizierung sei es möglich gewesen fast 72 Prozent der Entscheidungen zwischen Ausstieg und Fortsetzung anhand des Aktivitätsmusters im Gehirn korrekt vorherzusagen, schreiben die Forscher. An der Risikobewertung seien zwar viele Hirnreale wie Inselrinde, Striatum, Thalamus und Parietallappen beteiligt. Die Zahl zur Vorhersage nötiger Werte lasse sich aber stark reduzieren. Entscheidend seien die Datenmuster aus einzelnen Arealen, die typischerweise etwa Kontrolle, Arbeitsspeicher und Aufmerksamkeit beeinflussen.