Ein Jahr der Krisen endet"Krisenempfinden und psychische Belastung sind kein Wettbewerb"
 Von Rebecca Wegmann
Von Rebecca Wegmann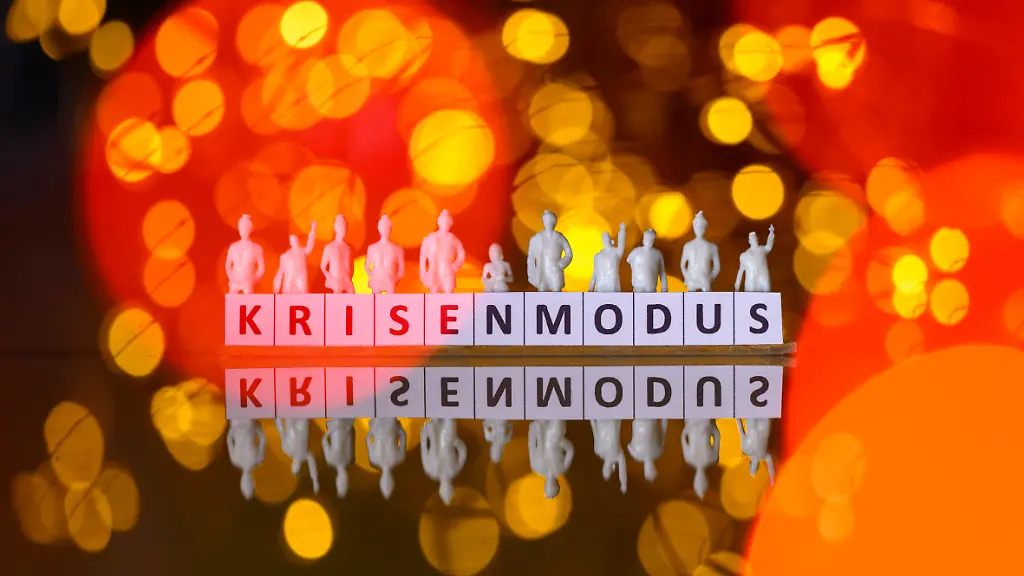
Deutschland empfindet 2023 eine Art Krisenblues: Klimawandel, Inflation und die Kriege in der Ukraine und in Nahost sorgen die Deutschen zunehmend. Ein Jahr des Krisenempfindens geht zu Ende und die Ängste scheinen größer als je zuvor.
Inflation, Kriege und die Folgen des Klimawandels sorgen für Krisenstimmung in Deutschland. Zuletzt kürte die Gesellschaft für deutsche Sprache den Begriff "Krisenmodus" zum "Wort des Jahres" 2023. Krisen habe es schon immer gegeben, im zu Ende gehenden Jahr schienen sie und ihre Bewältigung jedoch zu kulminieren, erklärte die Jury zur Begründung.
Steigende Preise im Supermarkt, Nachrichten von Kriegen und Gewalt in den Medien, sowie weltweite Naturkatastrophen - alle sehen, hören und fühlen die Krise. Auf dem Höhepunkt der gefühlten Krisen, kommt man nicht umhin sich zu fragen: War früher wirklich alles besser?
Früher war alles besser?
"Wenn man auf die Gegenwart schaut, hat man oft das Gefühl, die Gegenwart ist mehr von Krisen betroffen, als das in der Vergangenheit der Fall war. Jetzt ist eine besonders krisenbehaftete Zeit", sagt Historiker Frank Biess. Die Krisen sind in Deutschlands Gefühlshaushalt angekommen. Eine Erfahrung, die in Krisenzeiten viele machen: Angesichts aktueller Dauerbelastungen leiden einige an einer Art Zukunftspessimismus. Demgegenüber sieht die Vergangenheit durch die nostalgische Brille oftmals rosiger aus. "Es geht uns natürlich besser als in vielen Momenten in der Vergangenheit." Für ihn als Historiker sei es leicht, Sorgen und Ängste der Vergangenheit als überzogene Hysterie oder Neurosen zu verurteilen. "Doch wir haben den Vorteil, dass wir wissen, wie die Geschichte ausgegangen ist. Heute wissen wir, dass es keinen Dritten Weltkrieg gab - zumindest bis jetzt noch nicht", verneint Historiker Biess die Frage, ob früher wirklich alles besser war.
In seinem Buch "Republik der Angst" untersucht er die Emotionsgeschichte der Bundesrepublik, "die immer wieder von massiven Krisen geprägt war." Dabei sagen "uns die Ängste der Zeitgenossen etwas über die Vergangenheit - wie die Menschen damals die Gegenwart wahrgenommen haben."
Biess erläutert, dass die Abwesenheit eines Krisenbewusstseins historisch eher das Besondere war: "Nach dem Zusammenbruch des Kommunismus in den 1990er-Jahren herrschte im wiedervereinten Deutschland das Gefühl, dass alles eigentlich nur besser wird. Es gab die Vorstellung, dass die Globalisierung allen hilft." Der 11. September 2001 und der damit verbundene Schock habe mit diesem Zukunftsoptimismus gebrochen: Nicht alle Krisen waren gelöst. "Seitdem leben wir in einer Abfolge von Krisen: Finanzkrise, Eurokrise, Flüchtlingskrise, Corona, Krieg in der Ukraine, jetzt Krieg im Nahen Osten. Das sind Phänomene, die schon länger präsent sind: Doch in diesem Jahr treffen unterschiedliche Krisen zusammen, die sich zu einer Megakrise vereinen", begründet der Historiker die in Deutschland vorliegende Gefühlslage. Das Krisenbewusstsein resultiere aus "der kumulativen Krisenanhäufung, der Verunsicherung durch Zusammenhänge, die nicht mehr so ganz durchschaubar sind".
Andauernde Belastung
Auch Psychotherapeutin Christina Jochim, stellvertretende Bundesvorsitzende der Deutschen Psychotherapeuten Vereinigung, sieht eine Klimax verschiedener Krisen: "Wir rutschen von Krise zu Krise." Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie belasten immer mehr Stressoren das Leben der Menschen auch in Deutschland. Jochim betont, es sei angesichts dessen völlig normal, dass Menschen vermehrt Ängste und Sorgen hätten. All diese Krisen würden demnach ein persönliches Bedrohungserleben jedes einzelnen und damit ebenso große Verunsicherung in der deutschen Gesellschaft auslösen. Doch da Menschen in schwer belastenden Krisensituationen wie der Corona-Pandemie erst einmal weiter funktionierten, machten sich die Auswirkungen oftmals erst viel später bemerkbar. "Wir beobachten gerade bei Kindern und Jugendlichen eine massiv erhöhte psychische Belastung, den Verlust von Lebensqualität und den Anstieg von Ängsten und Depressionen."
In der ersten Zeit der Corona-Pandemie gab es eine Welle großer Solidarität. Doch je länger oder je mehr Menschen belastet sind, desto stärker nimmt das Mitgefühl für andere ab. Die Psychotherapeutin sieht eindeutige Folgen: "Wegen Dauerbelastung nicht nach den eigenen Werten handeln und leben zu können, führt potenziell zu Empathie-Müdigkeit, Zynismus und Abgestumpftheit."
Angst als Überlebensmechanismus
Näher rückende Existenzängste, latente Bedrohungsgefühle, wachsende Unsicherheit sind ebenfalls Folgen dieses Krisenempfindens. Angst empfinden viele als eine negative Emotion, trotzdem hat sie eine wichtige Funktion: Angst ist ein Überlebensmechanismus der Menschheit. "Sie gehört zum Leben dazu und schützt uns vor Gefahren. Und das ist auch gut so! Es ist nie das Ziel, keine Sorgen, keine Angst zu haben", erklärt die Psychotherapeutin Jochim. "Angst schützt uns vor realen Gefahren, wie zum Beispiel einfach so über eine fünfspurige Kreuzung zu laufen."
Gleichwohl hatten laut Historiker Biess bestimmte Angstphänomene auch produktive Auswirkungen auf die Geschichte Bundesrepublik, "weil sie eine Sensibilität für Gefahren schaffen und dazu führen, dass Gefahren früher wahrgenommen und Vorsichtsmaßnahmen getroffen wurden. Auch die Geschichte der Demokratie in Deutschland hat viel damit zu tun, denn die hiesige Angst vor dem Verlust der Demokratie hat eine Wachsamkeit produziert." So könne Angst ein wertvolles Warnsignal für Individuum und Gesellschaft sein.
Die bundesweite Umfrage "Die Ängste der Deutschen" befasst sich seit 31 Jahren mit den Sorgen der Bevölkerung. Seit 1992 befragt das R+V-Infocenter jährlich in persönlichen Interviews rund 2400 Männer und Frauen der deutschsprachigen Bevölkerung im Alter ab 14 Jahren nach ihren größten politischen, wirtschaftlichen, persönlichen und ökologischen Ängsten. Die repräsentative Umfrage findet immer im Sommer statt - dieses Mal liefen die Befragungen vom 12. Juni bis zum 20. August 2023, also vor dem Angriff der Hamas auf Israel.
Laut der R+V Studie drehen sich die Top-Drei-Sorgen der Deutschen in diesem Jahr um die Finanzen: Mehr als zwei Drittel (65 Prozent) der Befragten gaben an, dass sie sich vor anziehenden Preisen fürchteten. Direkt dahinter hatten 60 Prozent der Befragten Angst davor, dass Wohnen in Deutschland unbezahlbar wird. Die Angst vor Steuererhöhungen beziehungsweise Leistungskürzungen liegt mit 57 Prozent auf dem dritten Platz. Die Deutschen fürchten also vor allem um ihren Wohlstand. "Finanzielle Stabilität hat sehr viel mit Existenzsicherung und persönlicher Sicherheit zu tun. Aber Geld allein macht natürlich nicht glücklich", sagt Psychotherapeutin Jochim. "Die Inflation merken die Menschen vor allem im Geldbeutel." Viele spüren die finanzielle Unsicherheit in ihrer Lebensrealität.
Angst vor Überforderung des Staates: Typisch deutsch?
Die Angst der Deutschen vor einer Überforderung des Staates durch die Zahl der Geflüchteten positioniert sich im Gesamtranking Platz vier. Hier ging es zum Vorjahr um elf Prozentpunkte nach oben auf 56 Prozent. In der Angst vor der Überforderung des Staates sowie der Überforderung von politischen Führungskräften erkennt Historiker Biess ein Spezifikum typisch deutscher Ängste: "Die Vorstellung der Überforderung des Staates und damit verbunden die Angst davor, dass der Staat nicht in der Lage ist, die Gefahren oder die Bedrohung in den Griff zu kriegen, hat in Deutschland eine lange Tradition." In der Nachkriegszeit habe es große Zweifel an der staatlichen Sicherheit der noch jungen Bundesrepublik gegeben, letztendlich hätten nur die Amerikaner Sicherheit versprochen.
Früher hätten demnach Ängste und Krisen einen spezifischen Ort, oder einen spezifischen Grund, einen nationalen Rahmen gehabt. Es habe zumindest die Illusion bestanden, dass Krisen über bestimmte Maßnahmen eingedämmt werden könnten. "Doch die heutigen Globalisierungskrisen sind mit den Mitteln des Nationalstaats nicht zu bewältigen, also der einzelne Nationalstaat ist tatsächlich überfordert", erklärt der Historiker Biess einen wichtigen Unterschied gegenwärtiger Krisen zu denen der Vergangenheit. "Wenn man heute über die Klimakrise nachdenkt, gibt es nicht mehr nur den einen Auslöser für diese Krise. Der Klimawandel ist eine neue Herausforderung unserer Gegenwart, die es in der Vergangenheit so noch nicht gab." Auf gesellschaftlicher Ebene ist die Industrie, die auf Wachstum aus fossilen Energien basiert, einer der Auslöser der Klimakrise. Aber auch im alltäglichen Handeln, wie mit dem Auto zur Arbeit fahren oder die Wohnung heizen, hat jeder Mensch im Kleinen Einfluss auf diese große Frage der Menschheit. Zu bewältigen wird die Klimakrise nur global sein.
Suche nach Schuldigen
Eine Reaktion auf die massive Verunsicherung besteht immer auch darin, dass Teile der Gesellschaft die Komplexität der Krisenursachen vereinfachen: "Bestimmte Gruppen als vermeintlich Schuldige zu identifizieren und für die Krise verantwortlich zu machen, also zu sagen: 'Die ukrainischen Flüchtlinge sind schuld daran, dass der Staat so verschuldet ist, wenn wir denen so viel bezahlen'", erklärt der Historiker. Damit würden die "Schwächsten und diejenigen, die am wenigsten Ressourcen haben, die aus schierer Verzweiflung ihr Leben riskieren, um sich irgendwie bessere Perspektiven zu verschaffen, dafür verantwortlich gemacht, dass es uns allen angeblich so schlecht geht."
Biess warnt davor, dass populistische Kräfte vom kollektiven Krisenbewusstsein profitieren und die Verunsicherung der Menschen für ihre Zwecke nutzen könnten. "Ähnlich wie in den 1930er-Jahren stellen sich heute viele die Frage, ob die liberale Demokratie die richtige Form ist, um auf die bestehenden Probleme zu antworten", erkennt der Historiker eine Parallele der Gegenwart zum aufkommenden Nationalsozialismus.
Politik der Angst?
Die Psychotherapeutin Jochim sieht zusätzlich in der Informationsflut der Medien des 21. Jahrhunderts eine Ursache für das starke Krisengefühl: "Einerseits ist es wichtig, dass wir wissen, was um uns herum passiert. Damit wir als informierte Menschen bestimmte Entscheidungen treffen können. Anderseits sind wir Menschen für dieses Ausmaß an Reizen nicht gemacht, auf die wir keinen Einfluss nehmen können." Angesichts von Fake News, Manipulation bis hin zur KI stellten sich viele die Frage, inwiefern sie Berichterstattungen in den Medien vertrauen können? Um diesem Strang der kollektiven Verunsicherung entgegenzuwirken, "brauchen wir Vertrauen und Zuverlässigkeit in die Medien", fordert sie.
Auch der Historiker Biess merkt an, dass "wir heute in einer Zeit leben, in der die Kommunikation mit Gefühlen viel stärker ausgeprägt ist, als sie es in der Vergangenheit war. Noch in den 50er- und 60er-Jahren gab es eine große Skepsis, in der Öffentlichkeit Gefühle zu artikulieren. Möglicherweise war es in der Nachkriegszeit auch funktional, Gefühle zu unterdrücken, zu verdrängen oder zu verschweigen. Erst Ende der 60er-Jahre änderte sich diese Vorstellung." Seitdem etabliert sich die Kommunikation von Gefühlen als Form in der Gesellschaft und vor allem auf der politischen Bühne: So seien die Friedens- und Umweltbewegungen der 1980er-Jahre von apokalyptischen Angstszenarien getragen worden, auch, um politisch zu mobilisieren.
Inzwischen produzieren politische Akteure gezielt Ängste, um bestimmte politische Ziele zu erreichen. Politiker setzen Gefühle gezielt ein, auch um zu manipulieren. "Heutzutage sind Politiker auch eher bereit, Ängste offen zu artikulieren", so Biess. Auch das sei Teil dieses Krisenempfindens, "dass wir mehr bereit sind, uns Gefühle zuzugestehen".
Jammern oder Perspektivwechsel?
Obwohl die Gesellschaft als soziales Gefüge betroffen ist, wirken sich Inflation und andere Krisen sehr unterschiedlich auf die individuelle Lebensrealität der Menschen aus: "Wir sind zwar alle betroffen, aber nicht alle sind gleich betroffen", sagt Psychotherapeutin Jochim. Beispielsweise könnten Menschen mit hohem Einkommen bestimmte Dinge einfacher kompensieren als Menschen, die nicht wüssten, wie sie am Monatsende über die Runden kämen. "Natürlich geht es anderen Menschen schlechter. Aber Krisenempfinden und psychische Belastung sind kein Wettbewerb, sondern von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Nur weil es anderen schlechter geht, heißt das nicht, dass es einem selbst nicht auch schlecht gehen kann. In der Krise ist wichtig, die eigene Belastung nicht zu ignorieren und nicht zu bagatellisieren". Manchen hilft es, gerade in Krisenzeiten viel über die eigenen Gefühle zu sprechen. Auch Jammern kann ein Bewältigungsmechanismus sein.
Wenn das nicht weiterhilft, empfiehlt die Psychotherapeutin einen "realistischen Perspektivwechsel". Die Mobilisierung von Aktivität als Reaktion auf Angst sei eine Form, Gefühlen der Ohnmacht und des Kontrollverlustes etwas entgegenzustellen: Menschen sollten sich ernsthaft vor Augen führen, "was kann ich beeinflussen, was nicht. Auch wenn die meisten keinen Einfluss auf den Ukraine-Krieg haben, gibt es doch immer etwas, das ich als Person beeinflussen kann."
Eine andere Strategie, die Menschen im Umgang mit Angst helfen kann, ist "die eigene Krisensituation im Rahmen der eigenen Zeitgeschichte in Relation zu rücken". Auch hier sollten sich Betroffene demnach fragen: "An welchen Stellen kann ich heute wirklich nicht das machen, was ich eigentlich heute tun wollen würde. Was ich vielleicht letzte Woche noch konnte? Oder hat sich doch nicht so viel verändert?"
Schließlich stellt sich die Frage, worum es bei den gegenwärtigen Ängsten der Deutschen wirklich geht. Die Antwort der Psychotherapeutin ist eindeutig: "Am Ende geht es immer darum, mit der eigenen Not gesehen zu werden."
