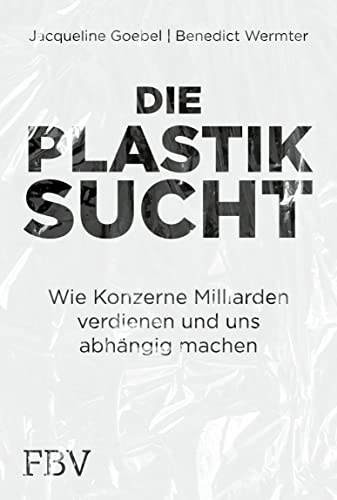Kriminelles Geschäft mit Abfall"Die mafiösen Strukturen beginnen bei Brokern und Müllmaklern"

Jeder Mensch in Deutschland verursacht im Schnitt 105 Kilogramm Verpackungsmüll im Jahr. Jede fünfte Verpackung wandert als Müll ins Ausland. Dort kommt der Abfall oftmals in die Hände der Müllmafia: "Müll verbrennen kostet 200 Euro. Wenn ich ihn in die Umwelt kippe, zahle ich 0 Euro."
Jeder Mensch in Deutschland verursacht im Schnitt fast 105 Kilogramm Verpackungsmüll im Jahr. Davon wird aber nur ein Teil recycelt und dieser auch nur teilweise auf heimischen Recyclinghöfen. Denn jede fünfte Verpackung wandert ins Ausland: "Historisch gesehen nach Südostasien und vor allem auch Osteuropa", erklären Jacqueline Goebel und Benedict Wermter im "Klima-Labor" von ntv. "Das ist legal, deutscher Müll darf in geprüften Anlagen auch im EU-Ausland recycelt werden", sagen die Journalisten und Autoren des neuen Buches "Die Plastiksucht". Doch die Realität sieht anders aus. Oftmals gerät Abfall in die Hände der Müllmafia, denn nicht nur Recyceln ist teuer: "Müll verbrennen, kostet 200 Euro. Wenn ich ihn in die Umwelt kippe, zahle ich 0 Euro."
ntv.de: In eurem Buch geht es unter anderem um die Müllmafia. Inwiefern eignet sich Müll für kriminelle Geschäfte und zum Geld verdienen?
Jacqueline Goebel: Man kann mit Müll sehr gut Geld verdienen, wobei es eigentlich umgekehrt läuft: Müll ist sehr teuer. Das Sortieren, die Entsorgung … es ist ein riesiger Aufwand, Rohstoffe aus einem Berg an Unbrauchbarem herauszufiltern. Wenn ich also viel für die Umwelt tun, den Müll gut und sicher entsorgen will, kostet es richtig Geld. In der Branche gibt es ein Sprichwort: Müll sucht sich das billigste Loch. Ich kann Geld verdienen, indem ich Müll verschwinden lasse, illegal entsorge und nur das rausfische, was tatsächlich Geld bringt. In Europa ist das nicht so einfach, weil wir die nötigen Strukturen und Kontrollen haben. Es gab aber über Jahre die Tendenz, den Müll ins Ausland zu schaffen, weil die Arbeitskosten dort günstiger sind und es einfacher ist, an der einen oder anderen Stelle etwas verschwinden zu lassen.
Der Müll wird mit einem Frachtflugzeug oder einem Containerschiff ins Ausland gebracht?
Jacqueline Goebel: Mit dem Containerschiff. Wir kaufen ja für viel Geld Waren in Asien ein und bringen sie mit dem Schiff nach Europa. Auf dem Rückweg sind die Container mehr oder weniger leer. Die wurden einfach mit Müll beladen, der kommt meistens in passenden Ballen. Das war der typische Weg, wie Plastikmüll aus Europa ins Ausland geschafft wurde.
Wo geht der Müll hin? Was ist das "billigste Loch"?
Benedict Wermter: Historisch gesehen, sind das Südostasien und vor allem auch Osteuropa. Da fährt dann aber kein Containerschiff, sondern einfach ein LKW hin. Im Prinzip finden sich "billige Löcher" überall dort, wo die Kontrollstrukturen nicht besonders entwickelt sind. Insofern sind der Balkan und Polen Hotspots für deutschen und britischen Müll. Auch die Türkei hat viele Müllexporte aus Deutschland und anderen westlichen Industrienationen aufgenommen.
Aber wenn die Container leer sind und diese Länder sagen: Gebt uns euren Müll, wir können damit wirtschaften - was ist so problematisch daran?
Jacqueline Goebel: An sich ist das kein Problem, das hat ja fast was von globaler Arbeitsteilung. Problematisch ist der Müll selbst. Wir nehmen an, Recycling sei einfach; Müll wird dadurch wieder zu Rohstoffen. Aber das stimmt nicht. Der Aufwand lohnt sich nur in ganz wenigen Fällen. Was mache ich mit dem Rest? Die Exportmengen sind zuletzt zurückgegangen, Müll bleibt also häufiger in Europa. Über Jahre ist er allerdings ins Ausland geschickt worden, um dort recycelt zu werden. Aber weil sich nun mal nicht alles recyceln lässt, wird viel gelogen und betrogen.
Welchen Müll schafft Deutschland denn ins Ausland? Wir recyceln doch eigentlich selbst recht viel mit Gelber Tonne und Gelbem Sack. Dieser Müll bleibt hier, oder?
Jacqueline Goebel: Fangen wir da mal an, wie viel Müll wird eigentlich recycelt? Jeder von uns Deutschen verursacht allein bei Leichtverpackungen 33 Kilogramm Verpackungsmüll im Jahr. Vor allen Dingen Plastik, das in die Sortieranlage geht. Die Recyclingquote für diesen Müll aus dem Gelben Sack oder aus der gelben Tonne liegt bei 63 Prozent. Aber nur zwölf Prozent des Plastiks, das wir in Deutschland nutzen, ersetzt Neuplastik. Es geht also eine ganz andere Menge in die Recyclinganlage hinein als am Ende herauskommt.
Weil zu viel deutscher Müll im Ausland landet?
Benedict Wermter: Nein. Aus Deutschland reist ungefähr jede fünfte Verpackung ins Ausland und wird zum Beispiel in Bulgarien zu Neuplastik verarbeitet. Das ist legal, deutscher Müll darf in geprüften Anlagen auch im EU-Ausland recycelt werden und geht trotzdem in unsere Abfallstatistiken mit ein. Aber für die Unternehmen in Bulgarien ist es lukrativer, Müll aus dem Ausland anzunehmen und sich dafür bezahlen zu lassen. Doch für jede importierte Tonne Müll wird eine lokale Tonne unter Umständen nicht recycelt und bleibt auf der Strecke.
Aber das hat ja nichts mit der Müllmafia zu tun.
Benedict Wermter: Die kriminellen Machenschaften sind das zweite Problem. Bei diesem Geschäft wird viel Schindluder getrieben. Nur weil eine Recyclinganlage im Ausland lizenziert ist, heißt das nicht, dass dort alles mit rechten Dingen zugeht. Zum Beispiel darf man nur bestimmte Sorten von Plastikmüll annehmen. Es kann aber sein, dass auch anderer Müll dort landet oder welcher, der eigentlich gar nicht zum Recycling vorgesehen ist. Dann wird es kriminell.
Und dieser Müll wird dann einfach ins Meer oder in die Natur gekippt?
Jacqueline Goebel: Das kann passieren, wenn die Importeure feststellen, dass sie mit dem Müll, den sie gekauft haben, nichts anfangen können.
Benedict Wermter: Genau. Aber das ist ein breites Feld. Es gibt Leute, die es nur auf kriminelle Geschäfte anlegen. Ganz genauso gibt es Entsorger, die legitim auftreten und einfach nur ihren Job machen wollen. Bei denen landet aber auch manchmal problematisches Material. Dann steigt der Druck, es illegal zu entsorgen.
An diesem Job verdient dann die Müllmafia?
Benedict Wermter: Die mafiösen Strukturen beginnen in der Regel bei sogenannten Brokern und Müllmaklern. Das sind Leute, die sich darauf spezialisiert haben, Müll zu vermitteln.
Das klingt wie die Börse.
Benedict Wermter: Tatsächlich ist das vergleichbar, es gibt zum Beispiel auch Spotpreise für den Müll in Sortieranlagen. Denn es wird ja nur ein Teil recycelt, der Rest muss teuer in der Müllverbrennung entsorgt werden. Das ist ein richtiges Geschäft mit Leuten, die kriminell vorgehen und sagen: Ich habe eine Verwertungsmöglichkeit irgendwo im Ausland. Wir haben die "grenzüberschreitende Abfallverbringung", wie der Fachbegriff heißt, gemeinsam mit Greenpeace und Peilsendern nachverfolgt. Der sind keine Grenzen gesetzt. Manche Leute in diesem Geschäft haben Verbindungen in den Drogenhandel und gehen mit Gewalt vor.
Jacqueline Goebel: Nehmen wir mal das Beispiel Schifffahrtscontainer. In den passen ungefähr 20 Tonnen Müll. Dieser Export ist legal, solange diese einzelnen Müllballen gut sortierten und recyclebaren Müll enthalten. Also packe ich die Ballen mit den guten Sachen wie Plastikflaschen - das sind super Wertstoffe, die sich toll recyceln lassen - nach vorne. Wenn ein Zöllner den Container öffnet, sieht er die und denkt sich: Das sieht gut aus!
Wie beim Kokain.
Jacqueline Goebel: Genau. Hinter den guten Ballen verstecke ich aber die dreckigen mit den Materialien, die nicht gut sortiert sind. In denen sich Folien und vielleicht auch Aluminium und andere Fremdstoffe befinden, die dort eigentlich nicht reingehören. Im Ausland hat mir aber jemand versprochen, dass er sich darum kümmert und Folien und Aluminium für einen guten Preis rausholt.
Und dann landet der Müll einfach irgendwo in Südostasien, wird verbrannt oder weggekippt?
Jacqueline Goebel: Zum Beispiel. Vielleicht merkt man aber auch an der Recyclinganlage, dass sich das Geschäft gar nicht rechnet. Denn eigentlich müsste der Rest in der Müllverbrennung entsorgt werden, die ist aber richtig teuer. In Deutschland kostet das mehr als 200 Euro die Tonne. Wenn ich den Abfall in die Umwelt kippe, zahle ich 0 Euro.
Mit Jaqueline Goebel und Benedict Wermter sprachen Clara Pfeffer und Christian Herrmann. Das Gespräch wurde zur besseren Verständlichkeit gekürzt und geglättet.