Konstruierte Schäden im LaborAlle Gene der Maus abschalten
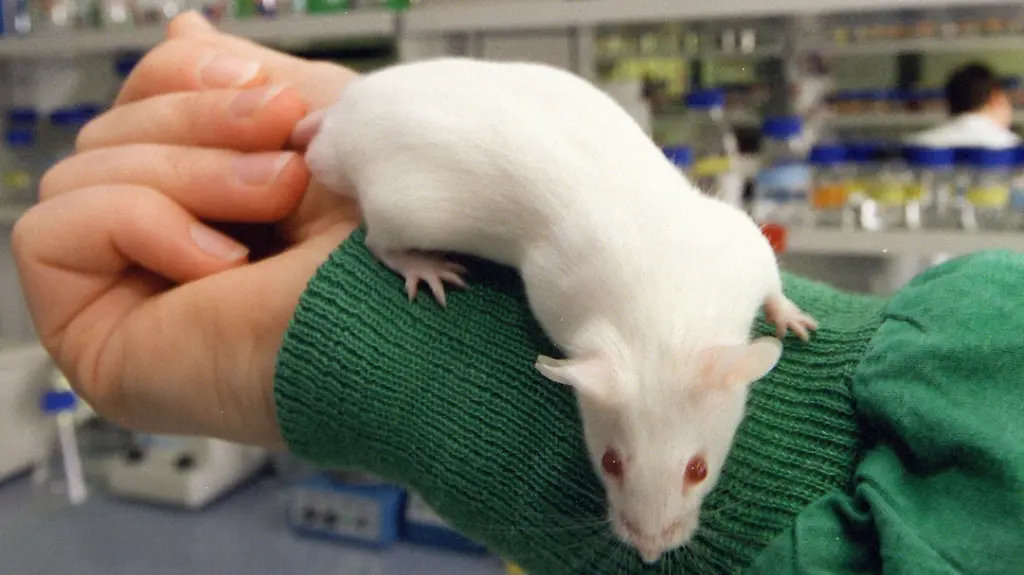
In einem unvorstellbaren Experiment wollen Forscher nach und nach alle 21.000 Erbanlagen der Maus abschalten. Den Genetikern gelingt bisher, 9000 der Gene gezielt auszuknipsen. Sie vergleichen ihren Versuch mit einem Uhrwerk, bei dem Einzelteile entfernt werden. Nur so können die Wissenschaftler die genauen Aufgaben der einzelnen Gene erkennen.
Ein Team britischer Genetiker hat bereits 9000 Gene in der Labormaus gezielt nacheinander ausgeschaltet. Mit ihrem in großen Teilen automatisierten Verfahren wollen sie auch den Rest der 21.000 Erbanlagen Stück für Stück stummschalten. Hintergrund der im Journal "Nature” präsentierten Arbeit: Die Experten möchten die Funktion einer jeden Erbanlage in der Maus kennenlernen. Viele Gene haben in der Maus und dem Menschen die gleiche Funktion – daher bringen die Tierversuche oft wertvolle Hinweise auch für den Menschen.
Wer wissen will, was ein Gen in der Maus tut, muss es zunächst allerdings zerstören. Die Folgen dieses provozierten Ausfalls zeigen, welche Aufgabe die betreffende Erbanlage im gesunden Tier hat. Dies lässt sich mit der Arbeit eines Mechanikers vergleichen, der aus einem unbekannten Uhrwerk ein Zahnrad entfernt und dann prüft, welche Zeiger verkehrt laufen, stehenbleiben oder abfallen.
Schädigungen nur am Tier zu beobachten
Um das zu erreichen, wird in Mäuse-Stammzellen gezielt ein kleines Stück der Erbsubstanz DNA eingeschleust. Dieses ist so konstruiert, das es sich gezielt an das auszuschaltende Gen anlagert. Danach kommt es zu einem Austausch, der sogenannten homologen Rekombination. Das intakte Gen ist danach gegen die neue Variante ausgetauscht. Aus den veränderten Stammzellen wird bei Bedarf eine Maus gezüchtet – erst das ganze Tier zeigt den Schaden.
Die neue DNA ist außerdem so trickreich konstruiert, dass sie zu einem besonderen Zeitpunkt mit einem Standard-Verfahren ausgeschaltet werden kann. Dann fehlt den Tieren etwa erst im Alter von drei Monaten ganz plötzlich das Gen – und auch diese Folgen werden sichtbar. Die sogenannte Knock-out-Technik brachte ihren Erfindern Mario Capecchi, Martin Evans und Oliver Smithies 2007 den Nobelpreis für Medizin.
"Knock-out-Technik" industrialisiert
Die Gruppe um William Skarnes vom Wellcome Trust Sanger Institute in Cambridge hat das Knock-out-Verfahren in großen Teilen automatisiert und stark beschleunigt, sprich: "industrialisiert". Das betrifft alle Schritte des Verfahrens: die Konstruktion der gewünschten DNA-Stücke, das Einschleusen in die Zellen, die Auswahl der tatsächlich veränderten Stammzellen. Ziel und Gegenstand der Arbeit ist immer der bestens bekannte und weit verbreitete Labormäuse-Stamm "C57BL/6".
Das Team erledigt dabei vor allem jene Arbeiten, die mit dem Ausschalten der Gene verbunden sind. Die Aufzucht der Tiere und damit verbunden die Charakterisierung der Mutationen ist Aufgabe anderer, darauf spezialisierter Gruppen.
Außer den bereits veränderten 9000 Genen haben Skarnes und seine Kollegen auch bereits DNA-Konstrukte für insgesamt die Hälfte aller 21.000 Mausgene geschaffen, teilen sie mit. Und: "Wir produzieren embryonale Stammzelllinien mit größerer Effizienz und Geschwindigkeit als vorhergesagt und auch über den historischen Durchschnittswerten."