Der Ex-Kanzlerin zum 70.So eine gibt's nie wieder
 Von Nikolaus Blome
Von Nikolaus Blome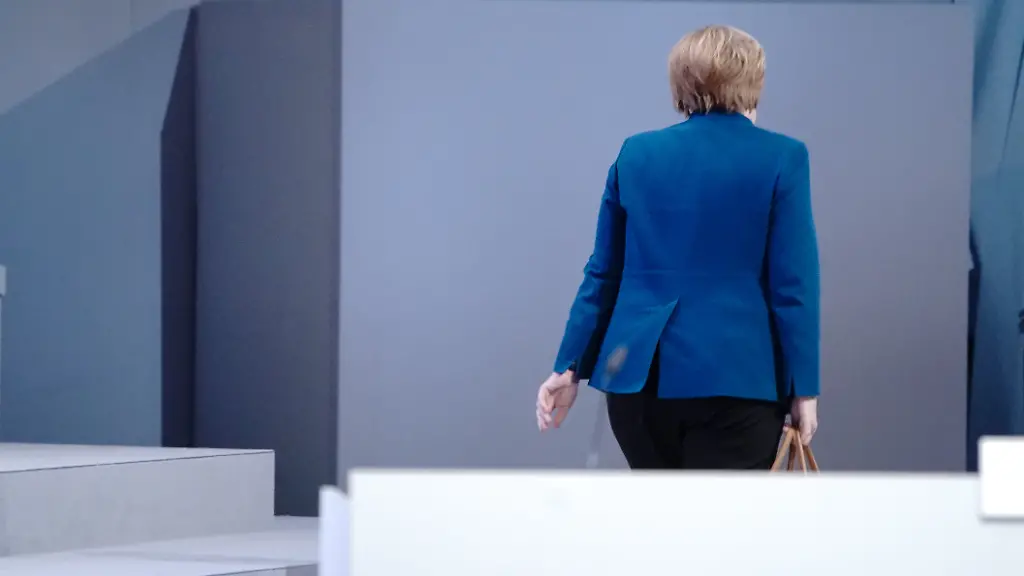
Angela Merkel hat Deutschland nicht nur durch die Krisen geführt. Sie hat mehr verändert als behauptet, aber am Ende viel zu lange regiert.
Still ist es um Angela Merkel geworden, selbst das hat sie geschafft, bald drei Jahre geht das schon so. Seit dem Ende ihrer Amtszeit hat sie der Deutung ihrer politischen Person nichts Nennenswertes hinzugefügt. Wer sich mit ihr aus Anlass des 70. Geburtstages also beschäftigen will, der muss sich zuvorderst eben daraus bedienen: aus ihrer Amtszeit, 16 Jahre, große Krisen, große Veränderungen, aber auch Jahre des Verschleißes und der Stille, die heute wie vergangene Vorzeiten wirken. Es gab Momente des Sieges und Phasen des Siechtums, Beweise ihrer Nähe zu den Leuten und eine Entfremdung, auf die mancherorts Verdrossenheit und Hass folgten. "Hau ab nach Berlin", schrill geschrien, und die höfliche Bitte um ein Lächel-Selfie zu zweit, beides konnte es bis zuletzt überall in Deutschland gleichzeitig geben, wenn Merkel auftrat.
Die 16 Jahre im Amt mit einer einzigen Schulnote zu bewerten, kann bei Lichte besehen nur irgendwo in der Mitte landen. Wozu das also? Wer ihr eine "Eins" geben möchte, kann von Migration, AfD und akuten Standortschwächen nicht viel mitbekommen haben. Wer nur eine "Sechs" für angemessen hält, benotet eine Politikerin, ohne Politik zu verstehen, und ignoriert sträflich die Europäerin Angela Merkel, die die letzte bürgerliche Volkspartei in der EU rettete, die CDU. Die "Eins" und die "Sechs", beides ist langweilig, nicht wahr? Beides ist milieutypisch berechenbar und ganz ohne Ehrgeiz, irgendetwas ernsthaft zu verstehen. Fast drei Viertel (74 Prozent) der Deutschen nennen ihre Amtszeit "eher gute Jahre", 22 Prozent "eher schlechte Jahre". Als Kanzlerin "vermissen" sie aber nur 40 Prozent, 58 Prozent tun das nicht.
"Alternativlos"
Warum stattdessen nicht diesen roten Faden nehmen: Angela Merkel und ihre Amtszeit erzählen mehr über uns als über sie selbst. Wer sah und hörte, wo Angela Merkel stand, der wusste stets auch, wo die deutsche Mitte lag. Zugleich hat sich Deutschland während ihrer Regierungszeit weit mehr verändert, als die ruhige Raute, ihre signature Geste, suggeriert. Denn das war ihr Weg: den Wandel nicht zu beschreien oder zu beschwören, sondern ihn irgendwann "alternativlos" wirken zu lassen, beiläufig zwingend, aber ein bisschen beliebig auch.
Von radikalen Reformen und ihrem klirrenden Sound ließ Merkel nach der Beinahe-Niederlage gegen Gerhard Schröder die Finger. Trotzdem brachte sie in der ersten Großen Koalition die größte Steuererhöhung der jüngeren Geschichte zuwege: drei Punkte bei der Mehrwertsteuer, heute wären das rund 50 Milliarden Euro jährlich. Und sie schaffte die größte Sozialreform seit der Agenda 2010: die Rente mit 67. Die Arbeitslosigkeit wurde in ihrer Zeit halbiert, die Forschungsausgaben verdoppelt, der Klimaschutz auf breiter Front massiv beschleunigt.
Zugleich verfolgte Merkel die Veränderung der CDU, ihrer Partei, mit zähem Nachdruck. Bei Familienbild, Ausländerpolitik, Staatsbürgerrecht, Minderheiten und Wehrpflicht oder Mindestlohn blieb am Ende fast kein Stein auf dem anderen in den Programmen der Partei. Die einen lobten es als "Modernisierung", und die anderen schimpften es "Sozialdemokratisierung". Was es auch sei: Wahlsiege in Reihe hat es möglich gemacht, doch die AfD eben auch.
Als Volkspartei hat Merkel die Partei in dem Maße verschoben, wie das Volk sich veränderte. Und es scheint heute müßig, darüber zu richten, wer diese Veränderungen jeweils antrieb: Merkel, die CDU oder das Volk selbst? Führung kann schließlich auch sein, wenn die Geführten gar nicht merken, dass sie geführt werden. Und ja, man kann den Deutschen eine Menge Veränderung zumuten, man darf damit nur nicht lauthals hausieren gehen. Merkels Klasse, aber auch ihre Grenzen treten hier zutage: Was sie als "machbar" sah, das wurde meist gemacht. Was sie als nicht machbar sah - weil nicht so bald mehrheitsfähig - das ließ sie ambitionslos liegen.
Das große Aufschieben
Die Deutschen sind nun einmal große Aufschieber - bis es nicht mehr anders geht. Das war bei Bildung so, bis der erste Pisa-Schock den Bund-Länder-Knoten sprengte. Das war bei der Agenda 2010 so, die Gerhard Schröder erst anging, als Deutschland fünf Millionen Arbeitslose hatte und der "kranke Mann" Europas war. Das war beim Klimaschutz so, der auf breiter Front das Tempo verdoppelte, als Fridays for Future 2019 die Straßen und die Debatten übernahm: Namens einer gesellschaftlichen Mehrheit trieben die jungen Leute die letzte Regierung Merkel vor sich her. Sie führten die Kanzlerin zu ihren Anfängen als "Klimakanzlerin" zurück: Das erste Kyoto-Protokoll hatte sie als Umweltministerin unter Helmut Kohl verhandelt.
Und schließlich: Das große Aufschieben wiederholt sich gerade ein weiteres Mal. Jetzt geht es um liegen gebliebene Investitionen, die gar nicht so häufig am Geld (oder neuen Schulden) scheitern als viel mehr an der stetig gewucherten Bürokratie: den vielen, vielen kleinen Vorbehalten vor Ort und auf allen behördlichen Ebenen. Viele dieser unterversorgten Investitionen sind allerdings Länder-Sache, in Schulen etwa, auch bei den meisten Straßen. Zweimal wurde unter Merkel der deutsche Föderalismus reformiert, um Klarheit und Zug in den staatlichen Aufbau zu bekommen. Doch es war nicht genug.
"Sie kennen mich"
Angela Merkel und ihre Amtszeit erzählen aber auch deshalb viel über Deutschland und die Deutschen, weil sie so permanent wie paradox Projektionsfläche war. "Alles, was in Deutschland passiert, hat irgendwie mit mir zu tun", hat sie einmal sinngemäß gesagt. Das beschreibt eine absolute Sonderstellung, wie eine Kanzlerin sie naturgemäß hat - dabei wirkte sie bis zur Farblosigkeit normal, wie jeder Mann, jede Frau. Als sie im Wahlkampf 2013 im TV-Duell ihren Herausforderer Peer Steinbrück mit dem Satz "Sie kennen mich" Schach-Matt setzte, hätte sie den Zuschauern genauso gut sagen können: "Sie kennen sich" - also wählen Sie mich!
Gleichzeitig ließ die Kanzlerin sich nie wirklich in die Karten schauen, was vielen politischen Unterstellungen erst den Raum gab. In Richtung der Bürger verströmte sie stets ein anmaßendes "Lassen Sie mich mal machen", das umfängliche Transparenz nicht für nötig erachtete. Lange kauften ihr die Leute das ab: Vertrauen durch Verähnlichung und Projektion. Eine Kanzlerin, die die großen Probleme des Landes und der Welt so angeht, wie man selbst daheim die eigenen angehen würde. Spektakuläre 41,5 Prozent waren 2013 das Ergebnis, AfD und FDP blieben unter fünf Prozent.
Beim Gewohnten und Vertrauten möglichst lange zu bleiben, ganz wie "normale" Deutsche es tun, entwickelten sich indes zu einem Fehler, der sich bis heute rächt. Statt 2013 eine schwarz-grüne Koalition zu wagen, entstand eine weitere Große Koalition mit der SPD: Der Rückbau der wirtschaftsbelebenden Agenda-Reformen begann, der bedürfnisblinde Ausbau des Sozialstaates, das Fahren auf Sicht und vielfach auch auf Verschleiß.
Bei der deutschen Energieversorgung lagen am Ende aller Eier in einem Korb - dem russischen. Die deutsche Industrie hat das billige Gas und Öl gern genommen, sie wurden jener Teil des deutschen Geschäftsmodells, der nun implodiert ist. Je weniger die Politik unter Angela Merkel da vorsorgte, umso brutaler und teurer war das Erwachen im Frühjahr 2022. So analytisch ihr Verstand ist, out of the box vermochte sie nicht zu denken. "Die Sowjets haben auch im tiefsten Kalten Krieg geliefert", sagte sie und verteidigte bis zum Schluss das Pipeline-Projekt Nord Stream 2. Dabei macht sie sich über Russlands Staatschef Wladimir Putins Charakter eigentlich keine Illusionen. Falsch gedacht, teuer bezahlt.
Innenpolitisch ist am Ende von drei Großen Koalitionen genau das eingetreten, wovor Historiker gewarnt hatten: Die extremen Ränder sind in einem Maße erstarkt, das Angst macht. Hat die Ostdeutsche Angela Merkel nicht gesehen, was sich da besonders im Osten der Republik entwickelt? Oder wollte sie nicht, weil sie sich gerade von dieser Biografie-basierten Erfahrung nicht leiten lassen wollte? Aus dem Osten zu stammen, galt lange Zeit als "Belastung", hat sie spät einmal eingeräumt. So wurde sie nach der Flüchtlingskrise 2015/16 und später wegen ihrer Corona-Politik ein letztes Mal zur Projektionsfläche: dieses Mal für die Wut auf alles, den bestimmte Milieus zunehmend in sich tragen.
Verantwortungserbe
Doch wer sich die kippenden Verhältnisse in den Niederlanden, in Italien, Frankreich oder Großbritannien anschaut, der muss Angela Merkel attestieren: Ihr Kurs hat die CDU vor dem Untergang bewahrt, wie er anderen bürgerlichen Volksparteien in Europa widerfahren ist. Für Deutschland ist das eine Versicherung - paradoxerweise gegen eine direkte Folge ebendieser Rettung der parteipolitischen Mitte, das Erstarken des rechten Randes.
Und hat denn Angela Merkel rein gar nichts riskiert? Doch, hat sie: für ihre Überzeugung, dass Europa an Deutschland niemals scheitern dürfe. Diese Linie hat sie von allen deutschen Kanzlern übernommen und durch ihre Zeit gezogen. Dieses Verantwortungserbe ließ sie Anfang der 2010er Jahre mit immensem Aufwand Griechenland im Euro halten. Dieses Erbe ließ sie die deutschen Grenzen offenhalten, als 2015 Tausende Kriegsflüchtlinge pro Tag darüber drängten. Und es ließ sie ein großes deutsches Tabu schleifen, als die Corona-Pandemie die europäische Wirtschaft verheerte: Merkel stimmte zu, EU-Schulden zu machen, mit gemeinsamer Haftung - also im Fall der Fälle deutscher Haftung allein.
Jede dieser Entscheidungen war zu Recht umstritten. Bei keiner davon wäre die Bestätigung in einer Volksabstimmung gewiss gewesen, im Gegenteil: Zwei davon wären vermutlich durchgefallen. Dass sie immer nur der Mehrheit gefolgt sei, ist also Unfug. Was sie der Mehrheit freilich versprach, war Ruhe nach jedem Sturm.
Das Land werde "stärker aus der Krise hervorgehen, als es in die Krise hineingegangen ist", so oder so ähnlich formulierte sie das. Es war das typische Versprechen aller halbwegs konservativen Pragmatiker, die in Krisen zu regieren haben und nach der Luft dafür suchen: "Liebe Bürger, wenn das hier vorbei ist, kriegt Ihr Euer altes Leben wieder zurück." Nach der Finanz- und nach der Euro-Krise traf das zu. Nach der Flüchtlingskrise (wenn sie überhaupt zu Ende ist) fanden viele Bürger, es träfe nicht mehr zu.
Darum führte diese Krise über chaotische Etappen und den Corona-Ausnahmezustand an das Ende ihrer Regierungszeit, das sie keineswegs allein und selbstbestimmt gestalten durfte. Ganz am Ende blieb der große Schlussakkord denn auch aus. Sie trat ab als eine Kanzlerin, die fast überall auf der Welt geradezu verehrt wurde, aber ihr eigenes Land über die Jahre eher weniger als besser verstand. In mehr als einer Hinsicht bleibt: So eine wie sie wird es nie wieder geben.
Heute wird Angela Merkel 70 Jahre. Glückwunsch.