Neue Variante setzt sich durchCoronavirus zeigt Anzeichen der Schwäche
 Von Kai Stoppel
Von Kai Stoppel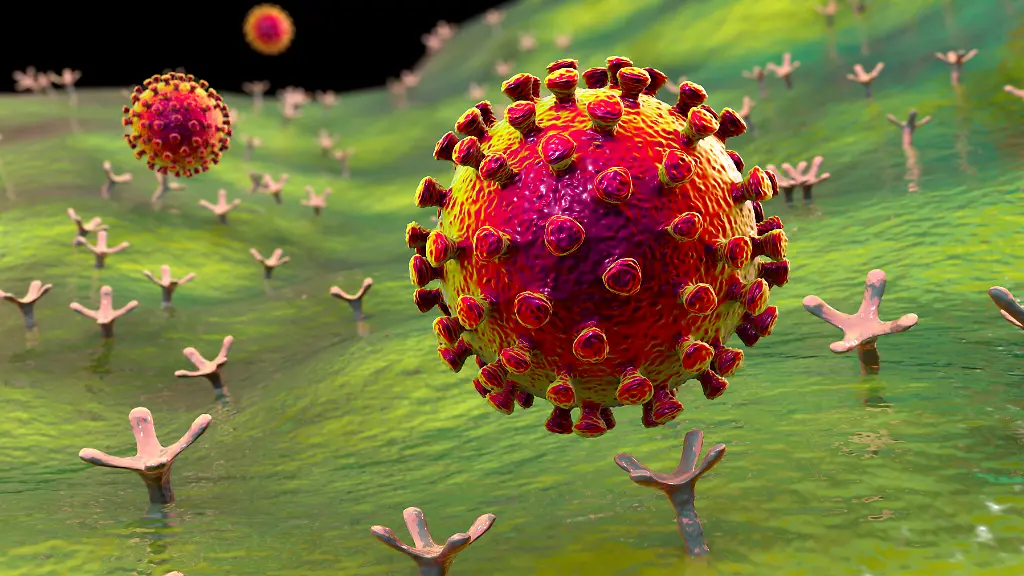
Experten sehen bereits Hinweise dafür, dass Sars-CoV-2 an Gefährlichkeit einbüßt. Dies könnte zugleich jedoch auf eine bessere Anpassung zurückgehen - und dem Erreger sogar nützen. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang zu einer neuen Variante, die sich derzeit weltweit durchsetzt.
Wird das Coronavirus Sars-CoV-2 sich mit der Zeit abschwächen und am Ende nur noch als Erkältung oder Schnupfen auftreten? Diese Hoffnung wird zuletzt vom Virologen Ulf Dittmer am Uniklinikum Essen befeuert. "Es gibt tatsächlich Hinweise darauf, dass sich das Virus bereits abschwächt. Und es könnte auch sein, dass das Virus im Zuge der Veränderungen irgendwann nur noch eine Erkältung oder einen Schnupfen auslöst", sagte Dittmer der "Bild"-Zeitung.
Der Virologe stützt seine Einschätzung vor allem auf zwei Beobachtungen: Zum einen gebe es in Ländern mit einer zweiten Pandemie-Welle weniger Todesfälle. Zum anderen werde bei Corona-Patienten immer häufiger eine Störung der Geschmacks- und Geruchsfähigkeit beobachtet, welche bei den Symptomen mittlerweile an erster Stelle stünden. "Aber gerade diese Symptomatik ist mit einem schwächeren Krankheitsverlauf verbunden", so Dittmer.
Tatsächlich fällt die Fallsterblichkeit weltweit, etwa in den USA, aber auch in Deutschland. Allerdings könnte dies auch am sinkenden Durchschnittsalter der Infizierten liegen, wie Dittmer selbst einräumt. Aber auch eine größere Vorsicht der Bevölkerung, das Abstandhalten und Tragen von Masken oder verbesserte Behandlungsmethoden nennen Experten als weitere mögliche Gründe.
Coronaviren schützen sich vor Mutationen
Allerdings haben Forscher bereits nachweisen können, dass das Coronavirus Sars-Cov-2 mutiert, was auch veränderte Eigenschaften zur Folge haben könnte. Doch geht die Mutation im Unterschied zu anderen RNA-Viren wie Influenza relativ träge vonstatten, da Coronaviren über einen eingebauten Kopierschutz verfügen. Denn Mutationen sind nicht zwangsläufig von Vorteil für ein Virus, sondern können es auch hemmen. Beim Replikationsprozess von Sars-CoV-2 wird das Genom daher noch mal überprüft, und unerwünschte Mutationen, die das Virus schwächen und seine Ansteckungskraft dämpfen könnten, werden dadurch vermieden.
Dennoch ist auch Sars-CoV-2 nicht vor Veränderungen durch Mutationen gefeit. Könnte der Erreger dadurch mit der Zeit also tatsächlich an Gefährlichkeit abnehmen? Eine derartige Entwicklung sei nicht ungewöhnlich, sagt Arzt und Medizinjournalist Dr. Christoph Specht ntv.de. Bei Erregern, die aus dem Tierreich auf den Menschen übertreten, gelten zwei Entwicklungen als typisch: Zum einen passen sie sich durch Mutationen mit der Zeit an ihren neuen Wirt an und können ansteckender werden. Zum anderen machen sie den Wirt, also den Menschen, dann aber oft weniger krank. Die Tödlichkeit sinkt also.
Immer ansteckender zu werden, ist ein evolutionärer Vorteil für Viren - denn dadurch können sie sich besser verbreiten. Charité-Virologe Christian Drosten hatte in einem NDR-Podcast Anfang Juni erklärt, wie zufällige Mutationen dazu führen können, dass sich das Coronavirus etwa noch besser in der Nase vermehrt und dadurch die Chance, auf andere Wirte überspringen zu können, erhöht. "Aber in der Nase werden wir nicht allzu krank davon", so Drosten. "Das heißt, das Ganze wird auf lange Sicht zu einem Schnupfen, der sich für die Lunge gar nicht mehr interessiert. So etwas könnte passieren."
Neue Mutation könnte der Schlüssel sein
Die Nase scheint für das Coronavirus tatsächlich eine wichtige Andockstelle zu sein: Was auch das häufig beobachtete Symptom der gestörten Geschmacks- und Geruchsfähigkeit erklären könnte, auf die der Essener Virologe Dittmer verweist. Denn laut einer aktuellen Studie konnten Forscher an der Riechschleimhaut der Nase besonders viele jener Rezeptoren nachweisen, an die das Coronavirus andockt, um sich zu vermehren. Dort befinden sich jedoch auch die Sinneszellen für das Riechen - werden diese durch das Virus angegriffen und beschädigt, können sie nicht mehr richtig arbeiten.
Gleichzeitig gibt es bereits Hinweise auf eine möglicherweise entscheidende Mutation bei Sars-CoV-2. Eine Studie von Forschern um die US-Biologin Bette Korber von Anfang Juli konnte nachweisen, dass sich eine mutierte Variante des ursprünglichen Virus bereits weltweit durchgesetzt hat. Diese G-Variante zeigt eine Mutation am Spike-Protein, mit dem das Virus an Zellen andockt. Wie die Forscher herausfanden, kann diese aufgrund der Mutation besser an menschliche Zellen andocken als ihr Vorläufer, die D-Variante - und ist nach Auskunft anderer Forscher um ein Vielfaches infektiöser. Zudem tragen mit der G-Variante infizierte Menschen eine höhere Virenlast in sich.
Die ansteckendere G-Variante war im März noch relativ selten, trat dann aber unter anderem von Europa aus ihren Siegeszug über die Welt an. Im Juli trugen bereits rund 80 Prozent der Patienten weltweit die neue G-Variante in sich. Paul Tambyah, designierter Präsident der Internationalen Gesellschaft für Infektionskrankheiten (ISID), hatte die Vermutung geäußert, dass die zunehmende Verbreitung der G-Variante weltweit mit der sinkenden Todesrate zusammenhängt. Dies ist jedoch umstritten. Zumindest aber scheint die neue Variante nicht gefährlicher zu sein als ihr Vorgänger: "Wir fanden (...) keinen signifikanten Zusammenhang zwischen dem Mutations-Status und der Schwere der Erkrankung und des Verlaufs", heißt es in der Studie des Korber-Teams.
"Vielleicht in ein paar Jahren" weniger gefährlich
Doch könnte sich die Mutation möglicherweise negativ auf die Suche nach einem Impfstoff auswirken? Sebastian Maurer-Stroh von der Agentur für Wissenschaft, Technologie und Forschung sagte der Nachrichtenagentur Reuters, dass die beobachteten Mutationen nicht ausreichten, um potenzielle Impfstoffe weniger wirkungsvoll zu machen. Die Virus-Varianten seien immer noch "fast identisch, und haben nicht jene Bereiche verändert, welche unser Immunsystem üblicherweise erkennt", so Maurer-Stroh. Für die Impfstoffentwicklung sollte dies also keinen Unterschied machen.
Dr. Specht hält es für wahrscheinlich, dass sich das Coronavirus Sars-CoV-2 zu einer Erkältung entwickeln wird, die weit weniger gefährlich verläuft. "Das könnte vielleicht in ein paar Jahren der Fall sein." Möglicherweise habe es in der Vergangenheit bei den vier bereits im Menschen vorkommenden Coronaviren, die ebenfalls meist nur harmlose Erkältungen verursachen, einen ähnlichen Verlauf gegeben. "Sie sind ziemlich sicher alle zuvor aus dem Tierreich auf den Menschen übergesprungen", so Specht. Nach einer anfänglich gefährlicheren Phase mit vielen Todesfällen könnten sie sich über lange Zeit massiv abgeschwächt haben. Möglicherweise liege der erste Kontakt mit Menschen schon Jahrhunderte zurück.