"Schlimmer kann's nicht werden"Gefühle für und mit Axel Hacke
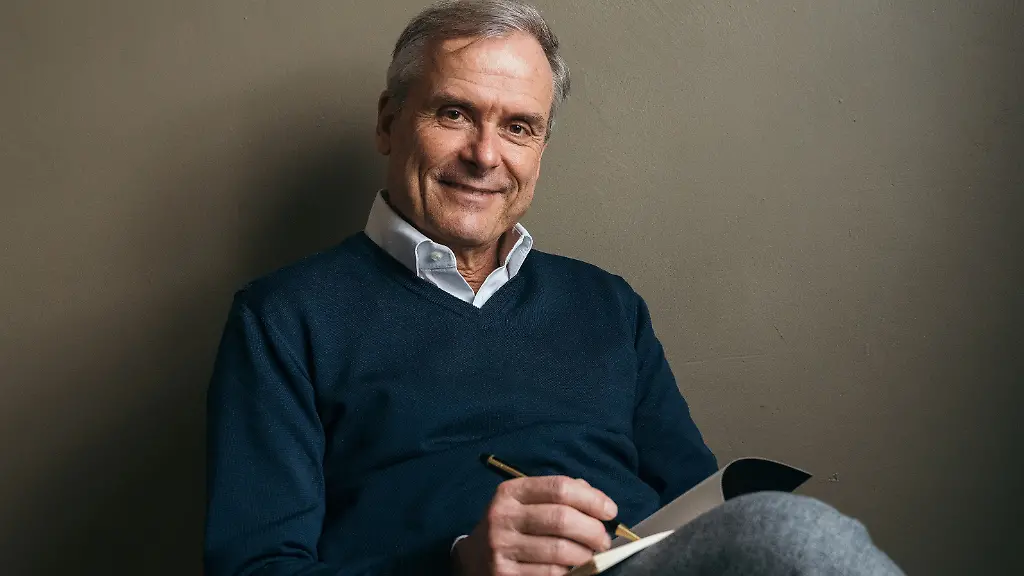
Sind Sie eigentlich dankbar? Und wie fühlen Sie sich heute? Fragen, die wir uns immer wieder stellen sollten. Axel Hacke hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, und nein, es ist weder befindlich noch eso. Der Bestseller-Autor hat sogar Hoffnung für die Menschheit.
"Gehört das schon zum Interview oder reden wir noch so dahin?", fragt Axel Hacke zu Beginn unseres Gesprächs, denn wir sind ins Plaudern geraten über Berge, Essen, Seen - und über meine Frage nach Ursula. Ursula ist seine Frau und ihr ist Hackes neues Buch "Wie fühlst du dich?" gewidmet. Darüber und dass der Besteller-Autor sogar noch Hoffnung für die Menschheit hegt, sprechen wir dann jetzt auch.
ntv.de: Ist Ursula vielleicht eine Zauberin, habe ich mich anfänglich gefragt …
Axel Hacke: Also, Ursula ist meine Frau, und da geht es natürlich um die Liebe. Insofern wahrscheinlich auch ein bisschen ums Zaubern. Sie hat mich mal gerettet, indem sie mich dazu brachte, mehr über meine Gefühle nachzudenken. (lächelt).
Dafür sind Sie sicher dankbar, oder? "Dankbarkeit" - ein Wort, das heute nicht mehr wegzudenken ist.
Dankbarkeit ist natürlich ein sehr vielfältiger Begriff. Und wie so viele Begriffe ist das Wort Dankbarkeit einfach integriert worden in die – ich nenne das mal – Ego-Gesellschaft. Dankbarkeit dient heute ja gern der Selbstoptimierung. Man führt Dankbarkeitstagebücher, damit man vielleicht noch leistungsfähiger wird und noch mehr aus sich herausholt. Aber das Wort Dankbarkeit tauchte auch auf, als der ukrainische Präsident Selenskyj im Oval Office zu Besuch war. Man herrschte ihn dort geradezu an, und fragte, warum er nicht dankbarer sei. Man hätte es auch andersherum aufziehen können: "Warum sind Sie denn nicht dankbar, dass ich die freie Welt gegenüber Russland verteidige?" Da ist Dankbarkeit durchaus zu einem Kampfbegriff geworden. Was es aber eigentlich bedeutet, ist doch: Dankbar für etwas zu sein, wofür wir nichts können.
Sie hatten anfänglich Angst, dieses Buch zu schreiben – warum?
Ich habe immer Angst, dass ich das nicht hinbekommen könnte. Aber bei genauerer Betrachtung ist das nicht unbedingt Angst, sondern eher Respekt. Respekt vor der Arbeit, die da zu tun ist. Das zu differenzieren, ist gut, denn Respekt ist etwas ganz Natürliches, ganz Normales. Wenn man vor seiner Arbeit keinen Respekt hat, dann könnte man sie nicht machen, man sollte es auch nicht. Deswegen ist man nervös. Deswegen bin ich nervös, genauer gesagt.
Wie lange haben Sie sich denn gewunden, anzufangen?
Lange (lacht). Ich musste sehr viel lesen, denn ich bin ja wahrlich nicht der erste, der zu diesen Themen etwas schreibt, und da wollte ich natürlich keinen Unsinn verzapfen.
Was hat Ihnen am meisten gebracht? Etwas Neues, oder etwas, was Sie bereits kannten?
Wir sind ja in einer Welt aufgewachsen, in der Verstand und Gefühl Gegner sind. Der Verstand hat dabei die Aufgabe, das Gefühl in den Griff zu bekommen. Das geht auf Descartes und seinen Satz "Ich denke, also bin ich" zurück, und das ist es, wenn man es philosophiegeschichtlich betrachtet. Aber es ist eben nicht ganz richtig, denn Gefühle führen uns doch an einen Punkt, an dem man überhaupt erst handeln kann. An dem man überhaupt erst anfangen kann zu denken.
Wenn ich Angst habe, dann bringt mich das dazu, mich zu fragen, wovor ich Angst habe? Und wie soll ich darauf reagieren? Insofern ist Angst ein Verhaltenskonzept, das in uns angelegt ist - und so ist das mit vielen anderen Gefühlen auch. Das war mir tatsächlich neu. Gefühle sind in uns nicht einfach vorhanden, wir produzieren sie, weil sie uns nützlich sind. Das ist übrigens nicht von mir, sondern von der berühmten amerikanischen Psychologin Lisa Feldman Barrett.
Sollte man viel mehr auf seine Gefühle hören?
Als Erstes sollte man ein Gefühl überhaupt mal erkennen. Dann sollte man das Gefühl differenzieren. Also zum Beispiel: "Das ist ja gar keine Angst, sondern einfach nur Nervosität." Dieses Gefühl bringt einen dann wahrscheinlich auf den Level, den man für bestimmte Tätigkeiten braucht. Feldman Barrett schreibt, dass es Menschen, die über ihre Gefühle sprechen, die sie zuvor differenziert haben, besser geht. Depressive Menschen können über ihre Gefühle ja nicht so gut reden, sie sind ihnen ausgeliefert, geradezu blockiert. Und das ist es, was ich mit meinem Buch meine: Man sollte sich jeden Tag fragen, wie fühlst du dich? Um sich über die eigenen Gefühle klar zu werden.
Nur wer seine eigenen Gefühle kennt, kann die Gefühle anderer wahrnehmen, richtig?
Vollkommen richtig. Je mehr man über etwas redet, desto mehr kann man verstehen. Das ist beim Fußball nicht anders als bei Gefühlen. Das führt zu einer gewissen Kompetenz und hat nichts mit Gefühlsduselei zu tun. Gefühle spielen in unserer Welt eine riesige Rolle.
Meine Kinder bedanken sich, wenn ich sie einlade, von A nach B fahre oder etwas koche. Habe ich mich bei meinen Eltern bedankt? Ich fürchte nicht, erst sehr viel später habe ich mich bedankt. Sie schreiben, etwas hätte sich verändert. Sind wir auf einem guten Weg?
Ich bin in einer Welt aufgewachsen, die geradezu gefühlsblind war. Über Gefühle hat man nicht geredet, schon gar nicht als Mann. Bei Konflikten hat man diese nicht unbedingt besprochen, sondern sich einfach angeschrien. Wir sollten jetzt am besten darauf achten, diese Fortschritte wirklich wahrzunehmen. Wir glauben ja immer nur, dass alles schlechter wird, aber das stimmt nicht. Homosexualität war bis 1994 noch strafbar, und als ich geboren wurde, durften Frauen ohne Zustimmung ihres Mannes keinen Führerschein machen, das ist doch heute unvorstellbar. Ich habe Hoffnung, dass es gut weitergeht, auch wenn die Zeiten gerade nicht so wirken. Ohne Hoffnung kann man nämlich nicht weitermachen. Und – es entstehen gerade auch ganz wunderbare Dinge.
Zum Beispiel …
Es gibt den Klimawandel, und es gibt dessen schlimme Folgen, aber es gibt auch ganz viele Menschen mit ihren Initiativen und Erfindungen, die dagegen angehen. Das macht mir Hoffnung. Nehmen wir unsere Kinder, die kommen auf der Welt noch mehr rum als wir; mein Vater beispielsweise hat Deutschland nur zu Zwecken des Krieges verlassen, danach nie mehr. Dieser Blick auf andere Länder ist etwas, was uns lernen lässt. Der Fortschritt war übrigens noch nie aufzuhalten. Man muss aber für ihn kämpfen.
Manchmal habe ich das Gefühl, nur Zuschauer zu sein - ich gucke dabei zu, wie Dinge flöten gehen, die Kultur sich auflöst, wie Krieg beginnt …
Wir sind überfordert, wenn wir als Einzelne versuchen, die Welt zu ändern. Das können wir nicht. Aber wir können es da, wo das Leben uns hingestellt hat, und wir können es zusammen mit anderen. Man kann etwas erreichen, da, wo man ist, wo man sich auskennt. Man kann es nicht allein daheim auf dem Sofa.
Bringt uns Freundlichkeit eigentlich weiter?
Damit werden Sie die Welt nicht ändern, aber es macht auf jeden Fall mehr Spaß, lächelnd durchs Leben zu gehen. Das sollte man immer mal wieder ausprobieren. Damit schaffe ich weder Rechts- noch Linksextremismus ab, das schaffen wir nur, wenn wir uns engagieren. Dazu gehört unter anderem das Wissen, dass wir nicht Kunden dieses Staates sind, sondern dessen Bürger. Man sollte das "Bürger-Sein" etwas wichtiger nehmen. Das bedeutet, von Anspruchshaltungen wegzukommen und die Dinge in die Hand zu nehmen.
Der typische "Deutschland-Kunde", also Bürger, stellt den Staat ja bereits als komplett dysfunktional dar, wenn die Züge sich verspäten ...
Ja, die Leute scheinen nicht in die Welt hinauszublicken. Und diese Haltung "Man gibt mir nicht das, was mir zusteht" ist genau der Ausdruck dieser Ich-Bezogenheit, in der der Gedanke vorherrscht, man könnte ständig Ansprüche stellen. So ist das aber nicht. Die Welt hat doch viel eher einen Anspruch an uns! Sich das klarzumachen, könnte gelegentlich helfen.
Der Gipfel des Egoismus spielt sich gerade in Form des Präsidenten der Vereinigten Staaten ab – was haben wir dem zu entgegnen?
Den Gedanken "schlimmer kann es nicht werden" in diesem Fall. Es ist ein Gipfelpunkt an Egoismus erreicht, nicht nur in den USA, der nur zur Folge haben kann, dass sich eine Gegenbewegung formiert. Eine Gegenbewegung, die auf das Verbundensein der Menschen setzt.
Wir sind umzingelt von Egoisten – darf ich die hassen? Darf ich andere verachten?
Es gibt ja keine Instanz, die Ihnen das verbieten könnte, Sie dürfen hassen (lacht). Sie müssen nur wissen, ob Sie das wollen. Hass ist ein zutiefst menschliches Gefühl. Man kann sich Gefühle nicht verbieten. Die Frage ist nur, will ich das wirklich? Will ich ein Mensch sein, der hasst? Oder ist das nicht doch ein wenig zu simpel?
Mit Axel Hacke sprach Sabine Oelmann
