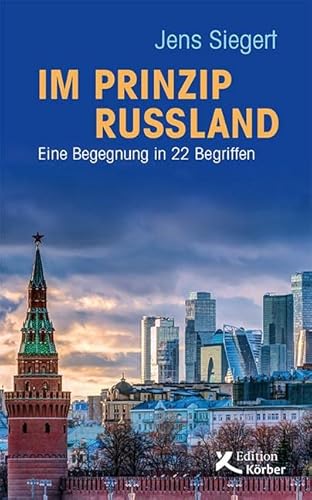Politologe zum Leben in Moskau"Viele glauben, Russland sei demokratischer als Deutschland"

Obwohl Russland seit zwei Jahren einen Krieg führt, ist in der russischen Hauptstadt davon nur wenig zu spüren, sagt der in Moskau lebende Politologe Jens Siegert. Im Interview mit ntv.de erklärt er auch, warum es so wenig Protest gibt - und wie er Russen dazu gebracht hat, auf Ukrainer Wodka zu trinken.
Der Politikwissenschaftler und Journalist Jens Siegert lebt seit 1993 in Moskau. Obwohl Russland seit zwei Jahren einen blutigen Krieg in der Ukraine führt, sei in der russischen Hauptstadt davon nur wenig zu spüren, sagt er im Interview mit ntv.de. Auch die Auswirkungen der Sanktionen könne man nur sehen, wenn man aufmerksam hinschaue, so der ehemalige Leiter des Russland-Büros der Heinrich-Böll-Stiftung. Im Gespräch erklärt er auch, warum es so gut wie keine Proteste gegen den Krieg gibt - und wie er Russen dazu gebracht hat, auf ukrainische Soldaten Wodka zu trinken.
ntv.de: Wenn Sie heute Abend einen Spaziergang durch Moskau machen, woran erkennen Sie, dass Sie sich in der Hauptstadt eines Landes befinden, das seit zwei Jahren Krieg führt?
Jens Siegert: Das wird schwer. Zumindest in der Innenstadt ist vom Krieg praktisch nichts zu bemerken. Vor einigen Wochen habe ich in einem Fenster des Hauptquartiers der Polizei ein großes Z und ein großes V gesehen. Aber solche Zeichen sind im Stadtzentrum ausgesprochen selten. Es gibt immer wieder Plakate, auf denen Soldaten oder Soldatinnen abgebildet sind. Und da steht der Name, der Dienstgrad und dass diese Person ein Held oder eine Heldin sei. Es wird nie gesagt, weshalb und wo diese Person Held oder Heldin geworden ist und ob sie noch lebt oder nicht. Aber natürlich verstehen alle, dass das in der Ukraine gewesen sein muss. In Moskau wird über den Krieg am besten geschwiegen oder hinweggegangen, er wird möglichst nicht bemerkt.
Bekommt man die Auswirkungen der westlichen Sanktionen zu spüren?
Spüren würde ich das nicht nennen. Man bemerkt sie nur, wenn man aufmerksam hinschaut. Nach dem 24. Februar 2022 gab es vor allem in den Einkaufszentren Leerstände, weil viele internationale Handelsketten verschwunden sind. Inzwischen sind da russische Firmen eingezogen, häufig mit einem sehr ähnlichen Profil, häufig auch mit Namen, die denen dieser internationalen Handelsketten ähnlich sind. Zum Beispiel Starbucks heißt jetzt Stars Coffee und das Logo sieht auf den ersten Blick dem von Starbucks sehr ähnlich.
Eine zweite Sache, die auffällt: Der große Teil der neuen Autos ist chinesischer Herkunft. Die hatten vor dem Krieg einen Marktanteil von unter 5 Prozent und sind jetzt auf fast 40 Prozent hochgegangen. Es gibt auch viele russische Ladas. Westliche Marken kommen als Neuwagen kaum noch vor. Mit einer großen Ausnahme - dem Luxussegment. Es gibt einen grauen Import, der nicht über die Hersteller, sondern über Drittländer und Dritthändler geht. Das kostet mehr. Aber Leute, die sich solche Autos leisten können, können sich auch diesen Aufschlag leisten.
Kann man also sagen, dass die Sanktionen die einfachen Leute viel mehr getroffen haben als die Reichen?
Das ist eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Wenn jemand mit seinem Gehalt ohnehin gerade so über die Runden kommt und jetzt noch 10, 20 oder 30 Prozent weniger Geld hat, ist das natürlich sehr schmerzhaft. Wenn jemand, der 200.000 Euro pro Monat verdient, jetzt 50 Prozent weniger hat, ist das zwar auch schmerzhaft, aber es bedroht nicht die Existenz.
Also insgesamt werden die Menschen schon ärmer?
Nicht unbedingt. Der Kreml hat auf Kriegswirtschaft umgestellt und es gehen enorme Investitionen in die Sektoren, die mit dem Krieg zusammenhängen. Das hat auch vielen ärmeren Leuten zusätzliche Einkommen gebracht. Soldaten, die einen Einjahresvertrag unterschreiben, um in der Ukraine zu kämpfen, bekommen bereits bei Vertragsabschluss bis zu einer Million Rubel Handgeld, das sind ungefähr 10.000 Euro. Selbst für Moskau ist das ein halbes Jahresgehalt, in den Regionen sind es leicht zwei Jahresgehälter. In den ärmeren Regionen kann man sich von diesem Geld ein kleines Haus oder eine Wohnung kaufen, oder die Schulden abbezahlen, die viele Menschen haben.
Sie haben den Kriegsbeginn in Moskau miterlebt. Wie war die Stimmung in der Stadt?
Die Stimmung war finster. Ich glaube, kaum jemand hat richtig damit gerechnet, dass so etwas wirklich passieren kann. Besonders unter Kriegsgegnern herrschte Niedergeschlagenheit oder gar Panik, weil niemand wusste, was das heißt. Ob der Krieg jetzt auch zu uns kommt? Müssen wir auch in den Krieg? Wachsen nun die politischen Repressionen? Das hat zu zwei großen Ausreisewellen geführt: gleich nach Invasionsbeginn und dann im September 2022, als der Kreml eine Teilmobilisierung erklärt hat. Damals haben insgesamt bis zu eine Million Menschen das Land verlassen.
Und wie war die Stimmung unter den Kriegsbefürwortern?
Ich habe in diesen zwei Jahren niemanden getroffen, der euphorisch für den Krieg ist. Wen man fragt: "Wie verhältst du dich dazu?", dann ist die Antwort oft: "Ich unterstütze Putin, es bleibt uns gar nichts anderes übrig." Viele glauben die Erzählung, dass diese Invasion notwendig war, weil die NATO und die Ukraine ansonsten Russland angegriffen hätten. Viele glauben, dass es ein Krieg um die Existenz Russlands ist. Aber es gibt keine Kriegseuphorie. Das sieht man auch an Umfragezahlen des Lewada-Instituts. 80 Prozent unterstützen Putin und den Krieg. Aber gleichzeitig möchten rund 70 Prozent, dass der Krieg so schnell wie möglich beendet wird.
Also es gibt viele Leute, die den Krieg beenden wollen. Es gibt auch viele, die direkt involviert sind, wie zum Beispiel Familien von Soldaten. Man sieht aber trotzdem kaum Protest, nicht mal von den Angehörigen der getöteten Soldaten, die eigentlich nichts mehr zu verlieren haben. Warum ist das so?
Na ja, sie haben schon was zu verlieren. Sie werden vom Staat sehr großzügig materiell kompensiert. Das ist so eine Art Schweigegeld. So wird es auch verstanden: Wenn ich mich beschwere, nehmen sie mir vielleicht nicht nur den Mann, Vater, Sohn, sondern auch das Geld weg. Also schweige ich lieber. Außerdem steht im Hintergrund diese allgemeine Auffassung, dass man ohnehin nichts tun kann. Das Gefühl der Machtlosigkeit, der Ohnmacht gegenüber dem Staat ist weitverbreitet.
Hat der Tod von Alexej Nawalny die Protestbereitschaft der Menschen irgendwie beeinflusst?
Es ist zu früh, das zu beurteilen. Aber ich fürchte, eher nicht. Trauer und Wut bringen zwar einige Leute auf die Straße, aber der Staat reagiert sofort mit Härte, Festnahmen und kurzen Haftstrafen. Zudem trifft auch hier zu, was für das Land insgesamt gilt: Leute werden aktiv, wenn sie eine Perspektive sehen, eine Chance mit ihrem Tun etwas zu verändern. Daran glaubt momentan so gut wie niemand.
Seit der Teilmobilmachung im Herbst 2022 gab es keine offenen Mobilisierungswellen mehr. Wie gelingt es dem Kreml, die Reihen der Armee weiter zu füllen?
Da gibt es verschiedene Methoden. Das eine war zum Beispiel, dass die Gefängnisse geleert worden sind, fast 50 Prozent der Gefangenen sind auf Bewährung entlassen worden. Und gleichzeitig gab es eine Anweisung an mögliche Arbeitgeber, diese Menschen nicht einzustellen. Viele von ihnen sind schließlich in den Rekrutierungsämtern der Armee gelandet. Und dann spielt auch das Handgeld, diese Möglichkeit, die Schulden schnell abzubezahlen, eine große Rolle. Es gibt immer wieder Erzählungen, dass der Familienrat sich zusammensetzt und zur Entscheidung kommt: Es geht nicht anders, du musst in den Krieg gehen.
Das ist ein bizarres Bild: Verbrecher sind auf freiem Fuß, sehr viele Menschen sterben, unzählige Familien verlieren ihre Angehörigen und gleichzeitig wirkt es so, als gehe das Leben normal weiter und sich nichts geändert hat.
Dieses Land ist in einer großen Verdrängungsphase. Man tut möglichst so, als ob es den Krieg nicht gibt. Man kann es Tanz auf dem Vulkan nennen - so wie in Europa vor dem Zweiten Weltkrieg. Andererseits ist da nicht sonderlich viel Tanz. Eher stilles Dulden. Ob es aber tatsächlich ein Vulkan ist, der irgendwann ausbricht, das wissen wir natürlich nicht.
Sie schreiben in Ihrem Buch "Im Prinzip Russland" von der weitverbreiteten Annahme, dass Russland keine Demokratie will und eine harte Hand braucht. Glauben Sie auch, dass es so ist?
Natürlich nicht. Ich glaube, dieser Gedanke ist rassistisch, wenn man einem ganzen Land abspricht, zu etwas nicht fähig zu sein. Was unterscheidet Menschen in Russland von denen in anderen Ländern? Eine politische Prägung, eine politische Geschichte. Aber nichts Grundsätzliches. Insofern bin ich der Überzeugung, dass Menschen in Russland zur Demokratie im Prinzip fähig sind. Wie die aussieht, wie sie sie haben wollen, ist eine andere Frage. Wenn man die Russen fragt, sind die meisten davon überzeugt, dass es in Russland demokratischer zugeht als in Deutschland. Das kann man uninformiert nennen, was es auch ist. Aber es ist eben nicht so, dass sie keine Demokratie wollen.
Also Sie glauben, dass Veränderungen doch möglich sind, dass es irgendwann vorbei ist mit der Diktatur?
Warum nicht? Alle Diktaturen gehen irgendwann zu Ende. Es hat ja auch in Russland die Perestroika gegeben. Es gab die Revolution am Anfang des 20. Jahrhunderts. Abgesehen davon: Nennen Sie mir mal ein Land, das im Laufe der vergangenen 250 Jahre demokratisch geworden ist, ohne davor eine Diktatur gewesen zu sein.
Gibt es wahrscheinlich nicht so viele.
Nein, denn das Diktatorische war früher die normale Staatsform. Alle haben sich aus diesem Sumpf heraus entwickeln müssen und kein Land hat es in einem Schritt geschafft. Viele Menschen mussten darunter leiden - in einigen Fällen auch Menschen in anderen Ländern. Da gehört zum Beispiel Deutschland dazu. Dass wir in Deutschland heute eine stabile - wenn auch im Moment etwas kriselnde - Demokratie haben, ist leider unter anderem auf den Leichen von vielen Menschen nicht nur aus Deutschland mitaufgebaut.
"Jeder kommt ins Gefängnis - niemand soll aufbegehren"Sie sind ein Deutscher, der in Russland lebt, also Vertreter eines feindlichen Landes. Propaganda spricht oft von deutschen "Faschisten", erinnert an die Nazi-Vergangenheit. Bekommen Sie Hass zu spüren?
Überhaupt nicht. Selbst in dieser politisch spannungsreichen Zeit gibt es hier eine für mich immer wieder verblüffende Deutschen-Freundlichkeit. Ich kenne auch Leute, die den Kreml im Prinzip unterstützen und mit denen man trotzdem ganz normal reden kann. Es gibt eben keine Kriegsbegeisterung. Wir waren im Sommer bei Verwandten meiner Frau im Altai. Und als wir eines Abends am Tisch saßen, hob jemand das Wodka-Glas und sagte: "Ich möchte auf unsere Jungs trinken, damit sie heil nach Hause kommen." Und dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Auf russische Soldaten trinken, in dieser Zeit? Ich habe dann gesagt: "Finde ich gut, aber ich glaube, wir sollten auch darauf trinken, dass die ukrainischen Jungs heil nach Hause kommen."
Und wie war die Reaktion in der Runde?
Kurz verblüfft und dann: "Ja, natürlich." Diese Geschichte hat allerdings zwei Seiten. Auf der einen Seite ist es nur allzu menschlich. Niemand möchte, dass Menschen sterben. Aber auf der anderen Seite ist da diese Erzählung von Putin: Wir kämpfen nicht gegen die Ukrainer. In der Ukraine sind Faschisten an der Macht, die benutzen unsere Brüder, die Ukrainer, und wir befreien sie. Also sind diese ukrainischen Soldaten in den Augen vieler Menschen in Russland eigentlich "unsere". Nur sind sie gezwungen, gegen uns zu kämpfen.
Fühlen Sie sich sicher in Russland?
Ja. Sonst würde ich Ihnen kein Interview geben. Ich habe bis jetzt keine Probleme gehabt. Wahrscheinlich verfolgt der FSB (Inlandsgeheimdienst - Anm. d. Red.), was ich so mache und sage. Ich würde mich jedenfalls sehr wundern, wenn das nicht der Fall wäre. Aber ich bin offenbar nicht wichtig genug. Oder sie sind noch nicht bei mir angelangt. Ist ja alles Arbeit und kostet Ressourcen. Was mir natürlich jederzeit passieren kann, ist, dass ich irgendwann aus dem Land rausgeschmissen werde. Aber deswegen den Mund zu halten, das geht nicht. Ein russischer Kollege hat einmal zur Frage, was, auch moralisch, richtig ist zu tun, bleiben oder gehen, gesagt: Man kann gehen. Man kann bleiben, dann muss man aber sprechen. Was man nicht kann, ist bleiben und schweigen.
Mit Jens Siegert sprach Uladzimir Zhyhachou