Heizfrage belastet Kommunen"Gas wird ein unfassbar teurer Wärmeträger werden"
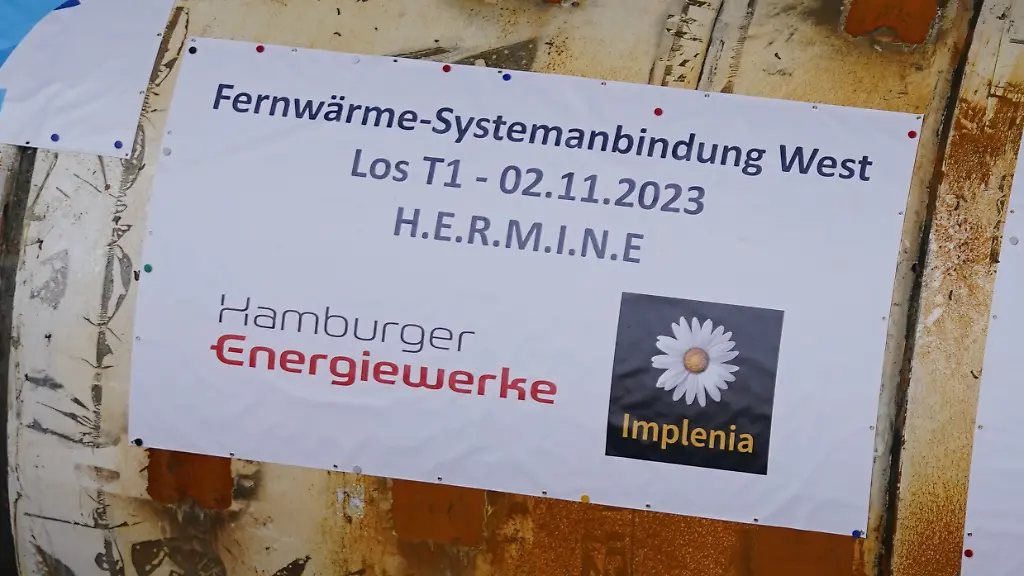
Die Kommunale Wärmeplanung verpflichtet alle 11.000 Kommunen zu sagen, wie sie Menschen und Wirtschaft in Zukunft klimafreundlich und gleichzeitig günstig mit Wärme versorgen wollen. Gerade für kleine Kommunen eine Mammutaufgabe, sagt ein TÜV-Experte. Neue Wut sei vorprogrammiert.
Die Kommunale Wärmeplanung verpflichtet alle 11.000 Kommunen in Deutschland dazu, einen Wärmeplan zu erstellen. Die größeren Kommunen haben noch zwei Jahre Zeit, um zu sagen, wie sie Menschen und Wirtschaft in Zukunft klimafreundlich und gleichzeitig günstig mit Wärme versorgen wollen; kleinere noch vier Jahre. Gerade für kleine Kommunen sei das allerdings eine Mammutaufgabe, sagt Mariusz Bodek. Denn denen fehlt es an Geld und Mitarbeitern, wie der Geschäftsführer von TÜV Rheinland Consulting im "Klima-Labor" von ntv erklärt. Stattdessen droht die Wut der Bürger: "Denen wird mit der Wärmeplanung suggeriert, dass sie sich zurücklehnen können", sagt Bodek. "Dann kommt das böse Erwachen: Nur der Anschluss ans Netz kostet Tausende Euro oder Fernwärme funktioniert gar nicht." Der Eindruck des Beraters ist vernichtend: "Der Schaden ist irreversibel."
ntv.de: Ist die kommunale Wärmeplanung aktuell die größte Herausforderung für die Kommunen?
Mariusz Bodek: Die Herausforderungen sind generell unfassbar vielschichtig, die Wärmeplanung ist aber die größte aufgezwungene. Wir haben knapp 11.000 Kommunen in Deutschland, davon 2000 städtische mit einer gewissen Größe. Und immer, wenn etwas zentralistisch beschlossen und föderalistisch ausgekippt wird, ist von den Kommunen eine gewisse Beweglichkeit gefragt.
Oder Kopfzerbrechen?
Es gibt Kommunen, die sind super unterwegs und machen das vorbildlich. Die beschäftigen sich aber auch schon seit Jahren mit diesem Thema. Wenn man sich das Gros anguckt, wird es schwierig. Egal bei welchem Thema, kleinere, ländliche Regionen stellen sich immer die Frage: Haben wir vor Ort jemanden, der das umsetzen kann?
Gerade kleinere Kommunen hadern mit der Wärmeplanung?
Ja. Die kommunale Wärmeplanung beinhaltet, wie die Wärme zuführenden Netze der Zukunft aussehen sollen, für die Bürger, aber auch für die Industrie. In den größeren Städten gibt es auch Herausforderungen, aber die sind durch die Mitarbeiterzahl in den Verwaltungen besser aufgestellt. In Hamburg sind etwa fünf Betreiber an den Verteilnetzen beteiligt, die einen herausragenden Datenbestand haben. Hamburg wird die Wärmewende wahrscheinlich nicht entspannt managen, aber auf jeden Fall gut. Dagegen gibt es im ländlichen Raum teilweise nicht mal klare Pläne, worauf die Wärmeplanung aufbauen soll.
Wie viele kleinere Kommunen werden an der Planung scheitern?
Für diese Frage ist es noch viel zu früh. Auch wenn die Kommunen unter der Belastung ächzen, habe ich bisher keine erlebt, die die weiße Fahne hisst und sich dem Thema nicht annimmt. Und das, obwohl der Bund den Schmerz dieser Diskussion mit der Gesetzgebung auf die Kommunen abgewälzt hat. Die müssen jetzt also nicht nur einen Transformationsplan erstellen, sondern gleichzeitig den Frust der Bürger ertragen - denen mit der Wärmeplanung gleichzeitig suggeriert wird, dass sie sich zurücklehnen können, weil wahrscheinlich Fernwärme kommt. Dann kommt aber das böse Erwachen: Das funktioniert gar nicht.
Weil es für die Kommunen zu teuer wird?
Man schätzt, dass der Anschluss eines Ein- oder Zweifamilienhauses an das Fernwärmenetz pro Meter 3000 bis 5000 Euro kostet. Meine Frau und ich leben in Hamburg in einem kleinen Reihenmittelhaus. Das Fernwärmerohr ist drei Meter entfernt. Das wären ohne Subvention oder Förderung nur für den Anschluss 9000 bis 15.000 Euro. Das Netz muss aber auch betrieben werden. Damit der Preis sinkt, brauchen die Versorger also genug Abnehmer. Je mehr Menschen allerdings eine Wärmepumpe oder andere Energieträger nutzen, desto weniger potenzielle Fernwärmekunden bleiben übrig, desto höher werden die Preise für die einzelnen Kunden sein. Gleiches gilt für Gaskunden: Je mehr Haushalte auf andere Wärmeerzeuger umsteigen, desto teurer wird es für sie, denn das Gasnetz muss ja weiter im vollen Umfang betrieben werden. Dazu kommt die CO2-Besteuerung. Gas wird ein unfassbar teurer Wärmeträger werden.
Ich vermute daher, dass sich viele Bürger allein aufgrund der Kosten gegen Fernwärme entscheiden werden. Die Hamburger Energiewerke haben übrigens schon klar gesagt: Hamburg wird Ein- und Zweifamilienhäuser definitiv nicht in den Fernwärme-Fokus nehmen, weil das unwirtschaftlich wäre.
Dort lohnt sich eher die Wärmepumpe?
Zum Beispiel. Schaut man sich aber nicht nur die Verteil-, sondern auch die Stromnetze in den Städten an, stellt man fest: Die Stromnetze sind für die Belastung durch viele Wärmepumpen gar nicht ausgelegt. Diese Infrastruktur muss erst hergestellt werden. Das ist auch Teil der kommunalen Wärmeplanung.
Sind die fehlenden Netze das Erste, worüber Sie und der TÜV mit den Kommunen bei der Wärmeplanung sprechen?
Den Kommunen ist dieses Problem bewusst. Die fragen eher: Woher soll ich das Geld für die Netze nehmen? Städtische Kommunen können im Etat einen Puffer einbauen oder sich verschulden. Was macht eine kleine Kommune? Die Leitungen sind unfassbar teuer. Es gibt eine Studie, die besagt: Allein der Ausbau der Stromnetze bis zum letzten Haushalt wird bis 2045 850 Milliarden Euro kosten. Wer soll das bezahlen? Das ist ein Fass ohne Boden, weil keiner weiß, was eigentlich gebraucht wird.
Die kommunale Wärmeplanung hilft gar nicht weiter?
Nein, weil das Kernproblem nicht gelöst wird. Wir sind uns einig, Klimaneutralität ist gerade im Gebäudebereich mit Blick auf Heizen oder Strom eine großartige Sache. Aber die Frage ist, wie man ein solch großes Vorhaben realisiert: Geht man mit der Brechstange vor und sagt "Wir heizen jetzt zu 65 Prozent erneuerbar!"? Das hat nicht unbedingt zu Zustimmung in der Bevölkerung geführt.
Das ist eine leichte Untertreibung.
Ich möchte es nicht zu weit fassen, aber letztlich wird dieser Staat aus Steuergeldern finanziert. Und wenn man die Steuerzahler wie beim Heizungsgesetz unmündig macht, ohne das vernünftig zu erklären, wird eine gute Idee beschädigt. Es wird sich zeigen, ob die Ampel genügend Zeit hat, diese Wahrnehmung im Kopf der Bürger umzustoßen. Mein Eindruck ist: Der Schaden ist irreversibel.
Und dann? Wann auch immer die nächste Bundestagswahl stattfindet, sehr wahrscheinlich wird die Union eine Mehrheit holen und als Erstes das Heizungsgesetz zurücknehmen. Was machen wir stattdessen? Fangen wir von vorn an und verlieren wieder Zeit, die wir nicht haben? Sie haben es selbst gesagt: Die Ziele ändern sich nicht.
Ich glaube nicht, dass das gesamte Gesetz gekippt wird. Wärmepumpen werden ein guter und relevanter Wärmeerzeuger sein und auch der Strompreis wird sich auf einem erschwinglichen Niveau einpendeln. Davon bin ich überzeugt. Das Gesetz muss aber angepasst werden. Und ja, der Gebäudesektor hat sehr viel Gewicht auf dem Weg zur Klimaneutralität dieses Landes, aber sollten wir uns gerade daran die Finger verbrennen?
Das machen wir lieber beim Verkehr?
Gute Frage. Es gehört offensichtlich zu den Grundbedürfnissen unserer Gesellschaft, dass man mit dem Auto hinfahren kann, wo es vielleicht nicht notwendig ist. Aber zurück zum Heizungsgesetz und zur Wärmeplanung: Die Umsetzung benötigt eine gewisse Mehrstufigkeit und nicht diesen einen Schalter, den alle umlegen. In den Gesetzen sind viele Thesen drin, denen vermutlich alle zustimmen, aber nüchtern betrachtet, sieht man: Es funktioniert nicht, in einem Zeitraum x alles umzubauen, was sich vorher über Jahrzehnte eingeschliffen hat.
Und diese Mehrstufigkeit sähe wie aus?
Wie eine Treppe. Wir haben herausragend ausgebaute Gasnetze. Nicht jeder Haushalt wird künftig noch mit Erdgas betrieben werden, es muss aber überlegt werden können, diese Netze für etwas anderes zu verwenden. Es gibt etwa beim Thema Biogas unfassbare Potenziale, aber keine Prüfung, ob unsere Netze dafür flächendeckend genutzt werden können. Diese Prüfung ist gar nicht vorgesehen. Es wäre gut, wenn man den Bürgern diese Brücke baut, ohne vom großen Ziel - Klimaneutralität bis 2045 - abzulassen.
Wenn man sich die Ergebnisse der Europawahl und der Kommunalwahlen anschaut, muss man doch festhalten: Ein Teil der Bevölkerung nimmt diese Themen gar nicht mehr ernst.
Das glaube ich nicht, sie priorisieren nur anders. Und als Privatperson sage ich ganz offen: Ich möchte in einem friedlichen Land leben. Und wenn dieses Land nicht in einen Krieg mit Russland eintritt und meine Tochter hier friedlich aufwachsen kann, priorisiere ich das höher als meine Heizung im Keller, auch wenn mir mit Blick auf den Klimawandel viele vorhalten werden: schwierige Einstellung.
Mit Mariusz Bodek sprachen Clara Pfeffer und Christian Herrmann. Das Gespräch wurde zur besseren Verständlichkeit gekürzt und geglättet. Das komplette Gespräch können Sie sich im Podcast "Klima-Labor" anhören.