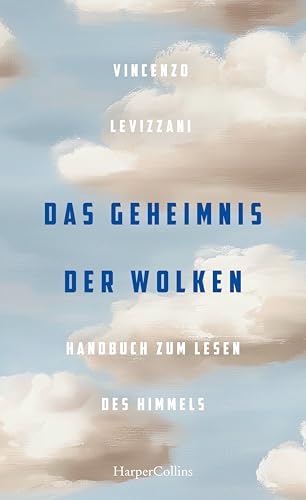"Wolken sind zu unterschiedlich"Wann bekommt der Mensch das Wetter unter Kontrolle?

Wolken spenden kostbaren Regen und spielen beim Klimawandel eine wichtige Rolle. Schon seit Längerem versucht der Mensch deshalb, sie unter Kontrolle zu bekommen. Ob das gelingen kann, und wie man die Wolkensprache erlernt, darüber sprach ntv.de mit Wolkenforscher Levizzani.
Der Mensch hat immer wieder versucht, über die Natur Herr zu werden. Gelungen ist es ihm noch nicht. Im Gegenteil, wie der Klimawandel beweist. Der Italiener Vincenzo Levizzani, Wolkenphysiker und Forschungsleiter am Institut für Atmosphärenwissenschaften und Klima des Nationalen Forschungsrats (CNR) ist Autor des Buchs "Das Geheimnis der Wolken - Handbuch zum Lesen des Himmels". Über Experimente mit dem Wetter, eine kostspielige Möglichkeit, mit Wolken den Klimawandel zu bremsen und das Erlernen der Wolkensprache spricht Levizzani mit ntv.de.
ntv.de: Herr Levizzani, zu Beginn eine provokative Frage: Wann wird der Mensch auch über das Wetter die Oberhand gewinnen?
Vicenzo Levizzani: Die Frage ist gar nicht so provokativ. Das Thema der Weather Modification wurde nämlich jahrelang studiert und erforscht. Man begann damit gleich nach dem Zweiten Weltkrieg. Bis jetzt aber ohne einen wirklichen Erfolg.
ntv.de: Warum klappt es mit der Kontrolle über die Wolken nicht?
Levizzani: Um das zu erklären, muss man wissen, wie sich eine Wolke bildet. Die Leute glauben, dass es nur der Wasserdampf und die von der Sonne erwärmte Luft sind, die sich beim Erreichen des Kondensationspunkts zu Tröpfchen und Eiskristallen formen und dann zu einer Wolke ballen. Das stimmt aber nur zum Teil. Es fehlt noch ein grundsätzliches Element, beziehungsweise fehlen die wichtigen Kondensationskeime. Gemeint sind die Aerosolpartikel, bei denen es sich, wenn sie natürlicher Herkunft sind, um Meersalz, Pollen, Mineralstaub oder Bakterien und Viren handelt. Zu den menschengemachten Aerosolen zählen die durch Industrie oder Landwirtschaft entstandenen Verschmutzungspartikeln.
Das erklärt auch den roten Regen?
Ja, wenn der Wüstensand als Kondensationskeim zur Bildung der Wolken beigetragen hat. Auch die salzige Meeresgischt, in der Chemie spricht man von Natriumchlorid, ist ein formidables Aerosolelement, das zur Bildung der Wolken beiträgt.
Warum ist das Weather Motification Project gescheitert?
Wissenschaftler der US Air Force waren der Meinung, man könne Wolken, aus denen es nur nieselt oder überhaupt nicht regnet, mit Aerosolpartikeln befruchten und somit die Niederschläge beeinflussen. Physikalisch gesehen ist an dieser Idee nichts falsch, trotzdem funktioniert sie in der Wirklich kaum oder überhaupt nicht. Die Wolken sind zu unterschiedlich. Der Kondensationskeim, der bei einer Wolke funktioniert, könnte sich bei einer anderen wirkungslos zeigen, auch wenn es sich um dieselbe Wolkenart handelt. Im Spiel sind auch Umweltbedingungen wie der Luftdruck und die Temperaturen. Deswegen haben die USA, Israel und Südafrika die Forschung unterbrochen. Die Chinesen und die Arabischen Emirate arbeiten stattdessen weiter daran. Sie haben wissen lassen, dass sie interessante Ergebnisse erzielt hätten. In der Wissenschaftsliteratur findet man aber keine neuen Erkenntnisse.
Was versteht man unter dem Ausbleichen der Wolken?
Es geht dabei um einen ganz feinen salzhaltigen Nebel, der in die Wolken geschossen wird. Auch hier handelt es sich um eine Befruchtung. Diese sollte über autonome, von Computer gesteuerte Katamarane auf hoher See erfolgen. Sie pumpen Wasser von der Meeresoberfläche, lassen es verdunsten und erzeugen so Natriumchlorid Kristalle, die dann durch Kamine, die bis zu 100 Meter hoch sein können, in die Atmosphäre geblasen werden.
In Ihrem Buch zitieren Sie den voriges Jahr verstorbenen Wissenschaftler Stephen H. Salter, der die These vertrat, dass die Verdampfung von zehn Kubikmetern Meereswasser pro Sekunde die Erderwärmung um 1,5 Grad Celsius senken könnte.
Die Idee der Wolkenbleiche fußt auf der Annahme, dass weißere Wolken eine höhere Kapazität haben, Sonnenstrahlungen in Richtung Weltraum zu reflektieren und somit die Temperatur auf der Erde zu senken.
Die Forschung daran scheiterte jedoch am Geld.
Stimmt, obwohl dieses Projekt einen besonders positiven Aspekt aufweist: Das verwendete Meeressalz hätte geringe Auswirkungen auf das Ökosystem. Die Kosten wären aber enorm. Wie ich im Buch schreibe, wären 100 bis 200 Millionen Dollar pro Jahr erforderlich. Ein weiteres Problem wäre die Umsetzung, die mindestens ein Jahrzehnt beanspruchen würde. Wobei davor noch das Verhältnis der Menge an benötigten Partikeln zur angestrebten Temperaturabsenkung geklärt werden müsste.
Was lernt und lehrt ein Wolkenphysiker wie Sie eigentlich?
Er lernt und lehrt die innere Struktur, den Aufbau einer Wolke. Was Wolken sind, dass sie Regen bringen können, aber nicht unbedingt, das wussten schon die Babylonier. Doch niemand wusste, wie es im Inneren einer Wolke aussieht. Dass sie aus Tröpfchen, Tropfen, Kristallen, Aggregaten, Graupeln, Hagel besteht, also aus Hydrometeors, wie wir diese Elemente nennen und auf die wir unsere Studien konzentrieren.
Was wiegt eine Wolke?
Eine Gewitterwolke kann auch mehrere Tonnen wiegen. Was natürlich stutzig macht. Denn wie kann etwas, das tonnenschwer ist, vom Himmel hinunterhängen, anstatt zu fallen? Das geht, weil die Wolken aus winzigen federleichten unabhängigen Teilchen bestehen. Und das wiederum erklärt, warum ihr spezifisches Gewicht sehr niedrig ist.
Hat der Klimawandel auch die Bildung von Wolken beeinträchtigt?
Die Antwort ist nicht leicht. Am besten geht es anhand von Beispielen. Nehmen wir die Stratocumuli. Wie man anhand der Satellitenbilder weiß, hängt über fast allen Ozeanen eine Stratocumuli-Decke. Eine Decke, die auf einer Höhe von bis zu 2000 Metern liegt und einen Durchmesser von circa 1000 Metern hat. Diese Schicht funktioniert wie eine Isolierdecke, die es vermeidet, dass die Temperatur auf der Erde zu sehr steigt. Es gibt aber Anzeichen, dass diese Wolkendecke wegen der Erderwärmung langsam dünner wird. Dadurch dringen mehr Infrarotstrahlungen auf die Erdoberfläche und die Meere werden wärmer. Ein zweites Beispiel hat mit den Niederschlägen zu tun. Auch diese haben sich stark geändert. Wobei jedoch, nicht in der Menge.
Das heißt, die Jahresmenge Regen hat sich nicht geändert?
So ist es. Was wir stattdessen erleben, ist ein tiefgreifender klimatischer Wandel. Heutzutage regnet es besonders heftig dort, wo es schon immer geregnet hat, und es regnet noch weniger, wo es schon immer zu wenig geregnet hat. So kommt es in Monsungebieten zu biblischen Unwettern, während im Mittelmeerraum und weitaus mehr am Horn von Afrika die Menschen von der schlimmsten Dürreperiode geplagt werden.
Sie schreiben, jeder kann die Wolkensprache erlernen. Wie soll das gehen?
Man legt sich auf eine Wiese, sieht den Wolken zu, wie sie sich verwandeln, wie sie vom Wind getrieben werden, wie sie von weiß, dunkelgrau und manchmal fast schon schwarz werden. Mit einem Handbuch und etwas Übung wird man sie nicht nur namentlich unterscheiden, sondern sie auch verstehen können. Wie ich in meinem Buch den Jungen rate: Mögen sie stehen bleiben und voller Staunen den Himmel betrachten, um ihn den Achtlosen zu erklären. Es ist wirklich faszinierend, was sich über unseren Köpfen abspielt.
Mit Vicenzo Levizzani sprach Andrea Affaticati