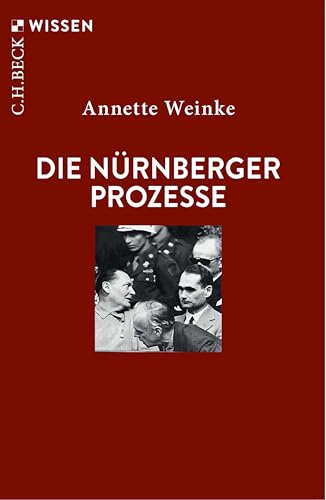80 Jahre Nürnberger Prozesse"Bei den Angeklagten gab es keinerlei Anzeichen der Reue"

Ein Bild geht im November 1945 um die Welt: In Nürnberg sitzen hochrangige Nationalsozialisten auf der Anklagebank. Sie werden zahlreicher Kriegsverbrechen beschuldigt. In den Nürnberger Prozessen ab dem 20. November soll nicht nur Recht über die Gräueltaten der Nazis gesprochen werden, sie haben auch aufklärerische Ziele, wie die Historikerin Annette Weinke im Gespräch mit ntv.de erklärt. Sie spricht über den Vorwurf der "Siegerjustiz", die Stimmung im Gerichtssaal, das Verhalten der Angeklagten - und die Akzeptanz der Prozesse bei den Deutschen.
ntv.de: Wenn jemand heute im Zusammenhang mit den Nürnberger Prozessen von "Siegerjustiz" spricht - was entgegnen Sie dann?
Annette Weinke: Einerseits ist es richtig, dass die Gerichtsherren auch gleichzeitig die Siegermächte waren. Insofern ist der Vorwurf der "Siegerjustiz" im Kern nicht ganz falsch. Aber letztlich ist der Vorwurf verfehlt, weil das Militärtribunal von 1945/46 in einem längeren Zusammenhang gesehen werden muss. Die Idee eines Völkerstrafrechts geht bis auf die Genfer Konvention von 1864 zurück. Im Zweiten Weltkrieg wurde sie wieder aufgegriffen. Es ging darum, ein Tribunal zu errichten, das schwere Völkerstraftaten ahndet, insbesondere solche an Zivilbevölkerungen.
Den Anklägern von Nürnberg war die juristische Kritik bewusst. Hatten sie mit dem Prozess noch ein anderes Ziel abseits der rein juristischen Ebene?
Die Prozesse hatten auch aufklärerische Ziele. Schon in der letzten Kriegsphase waren Untersuchungskommissionen unterwegs, die Beweismittel für Kriegsverbrechen gesammelt haben, die dann teilweise auch veröffentlicht wurden. Den Deutschen sollte zudem bewusst gemacht werden, dass man, wie es hieß, den aggressiven "preußischen Militarismus" ein für alle Mal stoppen und Deutschland zu einer friedlichen Nation erziehen wolle.
Wurde dieses Ziel erreicht?
Diese Frage wird in der Forschung nicht eindeutig beantwortet. Einerseits gab es für den Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher unter den Deutschen eine relativ hohe Akzeptanz - weil die Richtigen auf der Anklagebank saßen und zu Recht bestraft wurden. Aber die von den Amerikanern vorangetriebenen Nachfolgeprozesse wurden nicht mehr so ungeteilt befürwortet. Da kam das Schlagwort der "Siegerjustiz" auf, es gab Vorwürfe, dass Sündenböcke geschaffen und das deutsche Volk als Ganzes gedemütigt werden solle. Nach der Gründung der Bundesrepublik 1949 wurde dann schnell der Ruf laut, die Prozesse, aber auch die Entnazifizierung zu beenden. Strafrechtliche Aufarbeitung und politische Überprüfung wurden dabei in einen Topf geworfen.
Ursprünglich gab es die Idee der Alliierten, führende Nazis einfach zu erschießen. Warum kam es letztlich doch zu einer juristischen Aufarbeitung?
Die Exilregierungen von ost- und westeuropäischen Staaten in London bemühten sich ab 1942 um eine strafrechtliche Aufarbeitung der deutschen Verbrechen. Die Großmächte einigten sich dann im Oktober 1943 auf ein Vorgehen gegen die Hauptkriegsverbrecher. Das war noch relativ vage formuliert, denn es war noch gar nicht absehbar, wann und wie der Krieg enden würde. Erst ab 1944 gingen die Überlegungen in Richtung eines Prozesses, vor allem weil sich die USA und die Sowjetunion dafür aussprachen. Die Briten waren eher dagegen, und auch die Franzosen waren anfangs sehr skeptisch.
In der Sowjetunion hatte es da schon Prozesse gegeben.
Richtig, dort gab es schon ab Sommer 1943 Prozesse gegen sowjetische Kollaborateure, aber auch gegen Mitglieder von SS-Sonderkommandos sowie einzelne Vertreter der Besatzung und der Wehrmacht. Stalin soll laut einer unterschiedlich erzählten Anekdote sogar die Liquidierung des gesamten deutschen Generalstabs gefordert haben, also von 50.000 Mann, doch letztlich war er mehr an Schauprozessen interessiert. Und sowohl die Sowjetunion als auch die USA wollten Angriffskriege kriminalisieren. Das wurde dann im Sommer 1945 als strafrechtlicher Tatbestand in das Londoner Statut aufgenommen, das die Arbeit der Nürnberger Gerichte regelte.
Das wirkt mit Blick auf die Sowjetunion verwunderlich, wenn man an das geheime Zusatzprotokoll des Hitler-Stalin-Pakts denkt oder an den Überfall auf Finnland im Winterkrieg 1939.
Ja, das ist eine große Achillesferse des Londoner Statuts und des gesamten Prozesses: Die Sowjetunion hat sich 1939 selbst den Ostteil Polens einverleibt, dazu die baltischen Staaten, und den Krieg gegen Finnland vom Zaun gebrochen. Aber das spielte in der sowjetischen Selbstwahrnehmung keine Rolle, man sah sich selbst auf der richtigen Seite der Geschichte. Man darf nicht vergessen, dass die Sowjetunion mit 27 Millionen getöteten Menschen am meisten unter dem nationalsozialistischen Eroberungs- und Vernichtungskrieg gelitten hat. Sie wollte deshalb ein Zeichen setzen.
Die Zusammenarbeit von USA und Sowjetunion endete schon kurz nach dem Hauptkriegsverbrecherprozess. Hatte das im beginnenden Kalten Krieg vor allem politische Gründe?
Die Sowjetunion war mit den drei Freisprüchen in Nürnberg alles andere als glücklich. Mit Blick auf die eigenen Kriegsverbrecherprozesse gab es die Vorstellung, Tabula rasa machen zu können. Das gewünschte Ergebnis - Verurteilung und Hinrichtung aller Beteiligten - wurde nicht erreicht. Insofern war man der Meinung, von den eigenen Verbündeten in dieser Frage verraten worden zu sein.
Wie hat die Sowjetunion auf die Urteilsverkündung reagiert?
Da hat sofort die Propagandamaschinerie eingesetzt und man hat die Westalliierten bezichtigt, die Potsdamer Grundsätze verraten zu haben. Allerdings wollte auch die amerikanische Seite kein zweites Internationales Militärtribunal mit den Sowjets durchführen.
Wurde Nürnberg als Prozessort gewählt, weil die USA dort als Besatzungsmacht sozusagen Heimrecht hatten?
In gewisser Weise schon. Die Sowjetunion wollte das Tribunal in Berlin durchführen, konnte sich aber nicht durchsetzen. Als Zugeständnis fand dort lediglich am 18. Oktober 1945 die Eröffnungssitzung statt. Aber es gab auch praktische Gründe für Nürnberg: Der Justizpalast war relativ unbeschädigt und hatte die Dimension für ein Welttribunal. Nebenan gab es einen Gefängnistrakt, wo die hochkarätigen Angeklagten untergebracht werden konnten.
Und die USA konnten ihre Ressourcen ausspielen?
Im Prinzip spiegelte der Ort die realen Machtverhältnisse wider: Die Amerikaner waren mit ihrer ganzen wirtschaftlichen und bürokratischen Macht präsent, sie haben die größte Delegation gestellt, die meisten Vorarbeiten geleistet und sich im Laufe des Jahres 1945 voll mit diesem Vorhaben identifiziert. Auch auf logistischer und technischer Seite haben sie am meisten reingesteckt, zum Beispiel mit der aufwändigen Übersetzungstechnik. Das hätten die anderen Siegermächte so nicht umsetzen können.
Welche Stimmung herrschte denn während der Verhandlungen vor, wie haben die Journalisten darüber berichtet?
Für die beteiligten Journalisten war es nicht ganz einfach, dem Prozess zu folgen. Dieser war juristisches Neuland und die anwesenden Auslandskorrespondenten waren zum Teil einfach überfordert. Sie bekamen es mit komplizierten prozessualen Fragen zu tun, Dokumente wurden in den verschiedenen Sprachen verlesen - das alles war langatmig, ermüdend und schwierig zusammenzufassen. Die Journalisten standen auch unter einem ziemlichen Druck, die jeweiligen nationalen Interessen ihrer Medien darzustellen. Man durfte nicht verpassen, wenn es um das eigene Land ging.
Gab es während des Prozesses neue Enthüllungen über Gräueltaten der Nazis oder war vieles bereits bekannt?
Es gab Momente, die sich besonders im kollektiven Bewusstsein niedergeschlagen haben, zum Beispiel die Aussage von SS-Gruppenführer Otto Ohlendorf, dem Befehlshaber der Einsatzgruppe D der Sicherheitspolizei. Der hat auf emotionslose Art und Weise über die Ermordung von knapp 100.000 baltischen Juden und Jüdinnen gesprochen. Dass er so konkret und drastisch über Massenverbrechen sprach, hatte eine tiefe Wirkung. Zumindest auf die, die das interessiert hat. Man darf nicht vergessen, dass damals viele Menschen in Deutschland um das persönliche Überleben kämpfen mussten.
Gibt es Beschreibungen, wie die Angeklagten auf solche Darstellungen reagiert haben?
Tatsächlich waren die Amerikaner bestrebt, die Reaktionen systematisch zu erfassen, dafür waren sogar Psychologen vor Ort. Aber bei den Angeklagten gab es keinerlei Anzeichen der Reue, eher eine große Abwehr und Gleichgültigkeit. Eine Ausnahme war Albert Speer, der wohl als einziger in der Lage war, sich auf die Situation eines Strafprozesses einzustellen. Er trat vergleichsweise emotional und nahbar auf. Die anderen haben sich als Opfer stilisiert und die Vorwürfe zurückgewiesen.
Die Angeklagten konnten sich eigene Anwälte nehmen. Gab es da Absprachen für eine Verteidigungsstrategie?
Es gab auf jeden Fall die Bestrebung, eine gemeinsame Verteidigungslinie zu entwickeln. Das hat aber nur zum Teil funktioniert, weil sie in konkreten Situationen, in den Kreuzverhören, durchbrochen wurde. Letztlich waren die Interessen der Angeklagten doch zu unterschiedlich.
Man denkt bei den Nürnberger Prozessen vor allem an die Hauptkriegsverbrecher. Worum ging es dann bei den Nachfolgeprozessen?
Diese hingen mit einer bestimmten Interpretation der nationalsozialistischen Herrschaft zusammen. Vor allem die amerikanische Seite wollte die historischen Ursachen für den Aufstieg der Nazis untersuchen. Dazu haben Experten, darunter viele Menschen, die vor den Nazis aus Deutschland geflohen waren, Expertisen abgegeben. Die berühmteste ist "Behemoth" von Franz Neumann. Dieser verweist darauf, dass die traditionellen gesellschaftlichen Eliten im Schulterschluss mit den Nationalsozialisten das deutsche Staatswesen übernommen und zerstört haben.
Und diese Eliten standen dann vor Gericht?
Ja, dabei wurden Vertreter des Militärs, Diplomaten, Ärzte, Juristen, Beamte und Großindustrielle herausgegriffen und für ihre Beteiligung an der Konsolidierung der nationalsozialistischen Herrschaft und deren Verbrechen bestraft.
Die Nürnberger Prozesse sollten eine internationale Gerichtsbarkeit etablieren. Doch dazu kam es zunächst nicht. Warum?
Die Dynamik hin zu einem permanenten internationalen Strafgerichtshof schwächte sich Anfang der 50er Jahre stark ab. Das lag am Kalten Krieg, aber auch an der Dekolonisierung. Vor allem Großbritannien und Frankreich hatten kein Interesse an weiteren Kriegsverbrecherprozessen, weil man bei der Abwehr von Unabhängigkeitsbewegungen selbst Kriegsverbrechen verübte.
Das Thema verschwand?
Das Völkerstrafrecht war nicht völlig vom Tisch, wurde aber sehr vernachlässigt. Erst nach dem Ende des Kalten Krieges gab es wieder entsprechende Bemühungen mit Ad-hoc-Gerichten für das frühere Jugoslawien und für Ruanda. Dabei spielten die Nürnberger Prozesse eine herausragende Rolle, weil sie die Straftatbestände entwickelt hatten. Ende der 90er Jahre entstand dann der permanente Internationale Strafgerichtshof in Den Haag. Die in Nürnberg verhandelten Themen finden sich dort wieder: Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Verbrechen der Aggression und Kriegsverbrechen.
Mit Annette Weinke sprach Markus Lippold.