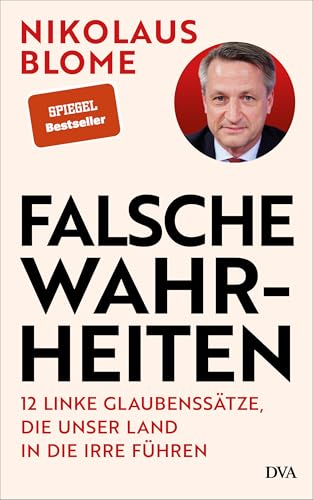Gender Pay GapGehaltslücke zwischen Männern und Frauen reduziert sich weiter

Dass Frauen im Schnitt weniger Gehalt bekommen, ist bekannt. Die Ermittlung einer unbereinigten Entgeltlücke zwischen den Geschlechtern hat allerdings wenig Sinn. Wird der Vergleich richtig gemacht, zeigt sich, dass Frauen noch immer zu kurz kommen, aber eben deutlich weniger.
Der Verdienstunterschied zwischen Männern und Frauen ist laut dem Statistischen Bundesamt im Jahr 2024 so stark zurückgegangen wie noch nie seit Beginn der Berechnungen im Jahr 2006. Demnach verdienten Frauen im vergangenen Jahr im Durchschnitt pro Stunde 16 Prozent weniger als Männer, wodurch der sogenannte Gender Pay Gap um zwei Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr sank. Doch dieser Wert ist unbereinigt. Hier wird nicht der Lohn einzelner Branchen oder Positionen, sondern der Durchschnittsverdienst aller Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen miteinander verglichen. Im Gegensatz zum bereinigten Gender Pay Gap.
Der unbereinigte Wert sagt denn auch wenig aus. Es ist ein Vergleich von Äpfeln mit Birnen, da unterschiedliche Stellenprofile gegenübergestellt werden. Für eine präzise Überprüfung der Entgeltlücke müssen identische oder sehr ähnliche Stellenprofile miteinander verglichen werden.
Bereinigt maximal 6 Prozent weniger
Bei vergleichbarer Tätigkeit, Qualifikation und Erwerbsbiografie verdienten Frauen im Jahr 2024 demnach pro Stunde unverändert 6 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen. Allerdings sollte bei diesem Wert beachtet werden, dass die Gehälter des öffentlichen Dienstes in die Berechnung nicht einfließen. Dort sind die (nominalen) Gehaltsunterschiede geringer als in der Privatwirtschaft. Noch dazu ist davon auszugehen, dass die Unterschiede noch geringer ausfallen würden, wenn weitere Informationen über lohnrelevante Einflussfaktoren für die Analyse zur Verfügung stünden, etwa Angaben zu Erwerbsunterbrechungen aufgrund von Schwangerschaft, der Geburt von Kindern oder der Pflege von Angehörigen, wie die Statistiker zu bedenken geben. Der bereinigte Gender Pay Gap ist daher als "Obergrenze" für eine mögliche Verdienstdiskriminierung von Frauen zu verstehen.
Der Rückgang des unbereinigten Gender Pay Gaps ist vor allem auf die stärkere Entwicklung der Bruttomonatsverdienste (ohne Sonderzahlungen) von Frauen zurückzuführen. Ausgehend vom unbereinigten Gender Pay Gap lassen sich rund 63 Prozent der Verdienstlücke durch die für die Analyse zur Verfügung stehenden Merkmale erklären.
Im Jahr 2024 stieg der Bruttomonatsverdienst der Frauen gegenüber 2023 um rund 8 Prozent von durchschnittlich 2633 auf 2851 Euro. Der von Männern stieg schwächer um rund 5 Prozent von 3873 auf 4078 Euro. Die durchschnittlichen monatlichen Arbeitszeiten von Frauen und Männern erhöhten sich nur geringfügig. Sowohl Frauen als auch Männer arbeiteten im Jahr 2024 mit 122 beziehungsweise 149 Stunden im Durchschnitt etwa eine Stunde mehr pro Monat als im Jahr 2023.
Der Verdienstunterschied lässt sich laut Statistischem Bundesamt zum Teil mit strukturellen Gründen erklären. So arbeiten Frauen häufiger in Branchen und Berufen, in denen schlechter bezahlt wird. Der Anteil sank 2024 auf 21 von zuvor 24 Prozent. "Das könnte darauf hindeuten, dass Frauen inzwischen verstärkt in besser bezahlten Berufen und Branchen arbeiten", so die Statistiker.
Ein weiterer Faktor, um den Verdienstunterschied zu erklären, ist der Beschäftigungsumfang: Frauen sind häufiger in Teilzeit beschäftigt, was in der Regel mit geringeren durchschnittlichen Bruttostundenverdiensten einhergeht. Dies macht den Angaben zufolge rund 19 Prozent des Verdienstunterschieds aus. Etwa 12 Prozent der Verdienstlücke lassen sich durch das Anforderungsniveau des Berufs erklären.
Die verbleibenden 37 Prozent des Verdienstunterschieds können nicht durch die im Schätzmodell verfügbaren Merkmale erklärt werden, wie das Statistikamt anmerkt.