Daten von 130 Millionen MenschenKönnen Infektionen das Demenzrisiko beeinflussen?
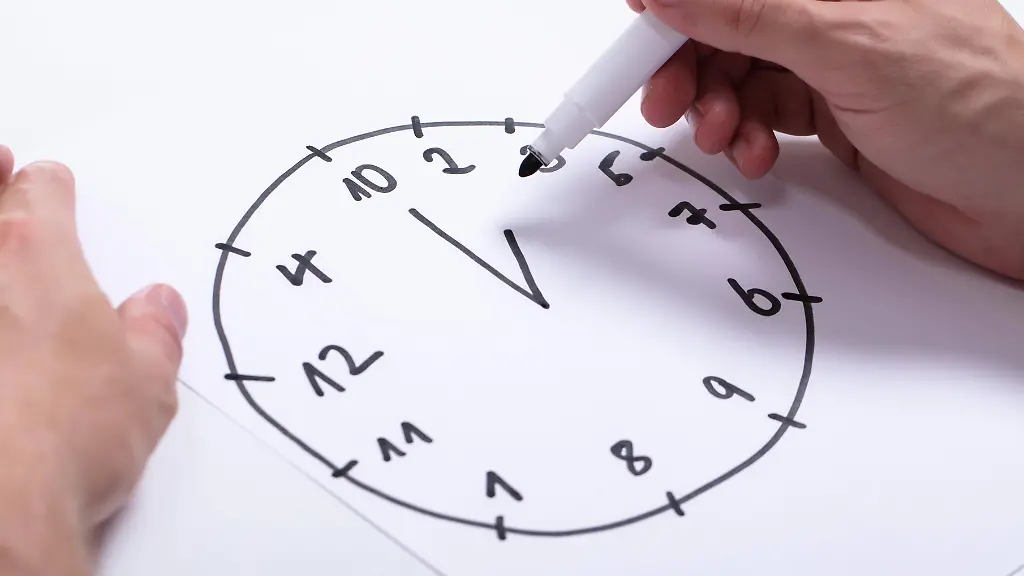
Eine umfassende Datenanalyse deutet darauf hin, dass Infektionen das Demenzrisiko erhöhen und bestimmte Medikamente es verringern können. Die Forschung bestätigt bisherige Annahmen und bietet neue Ansätze. Doch Vorsicht ist bei der Interpretation der Daten geboten.
Eine große Datenanalyse stützt die Hypothese, dass virale oder bakterielle Infektionen das Demenzrisiko erhöhen können. Die Nutzung von Antibiotika, schützenden Impfungen und entzündungshemmenden Medikamenten lasse sich mit einem geringeren Demenzrisiko in Verbindung bringen, berichtet das Forschungsteam im Fachjournal "Alzheimer's & Dementia: Translational Research & Clinical Interventions". Es schreibt: "Unsere Ergebnisse unterstützen die Hypothese und verleihen diesen Wirkstoffen weiteres Gewicht als potenziell krankheitsmodifizierend oder präventiv bei Demenz."
Demenzformen wie Alzheimer seien aktuell eine der größten Herausforderungen für die Medizin und das öffentliche Gesundheitswesen, so das Team. Ein möglicher Weg der Suche nach Therapien sei neben der klassischen Erprobung neuer Wirkstoffe die potenzielle Nutzung vorhandener, bisher gegen andere Krankheiten eingesetzter Medikamente.
Daten von 130 Millionen Menschen
Die Forschenden um Ben Underwood von der Universität Cambridge hatten in ihrer Übersichtsarbeit 14 Studien mit Gesundheitsdaten von über 130 Millionen Menschen einbezogen. Die meisten verwendeten Daten stammen aus den USA (9), die übrigen aus Japan (2), Südkorea (1), Deutschland (1) und Wales (1). Rund eine Million Demenzfälle waren insgesamt erfasst. Geprüft wurde, ob sich in den Daten ein Zusammenhang zwischen der Nutzung bestimmter verschreibungspflichtiger Medikamente und dem Demenzrisiko ergab. Gezeigt wird auf diese Weise ein statistischer, aber kein direkter ursächlicher Zusammenhang.
Insgesamt mangele es den Studien an Konsistenz dabei, einzelne Arzneimittel zu identifizieren, die das Risiko für Demenz verändern. Bei einzelnen Medikamentenklassen zeige sich aber durchaus ein durchgehender Zusammenhang, der auch mit zuvor veröffentlichten Studien übereinstimme und biologisch plausibel sei. Antibiotika, Virostatika, bestimmte Schutzimpfungen (Hepatitis A, Typhus, Hepatitis A und Typhus kombiniert, Diphtherie) sowie entzündungshemmende Medikamente lassen sich demnach mit einem geringeren Demenzrisiko in Verbindung bringen.
Fördern Infektionen neurodegenerative Erkrankungen?
Studien, wie eine Anfang 2023 im Fachjournal "Neuron" veröffentlichte, weisen schon länger darauf hin, dass Infektionen mit bestimmten Erregern mit einem erhöhten Risiko für neurodegenerative Erkrankungen einhergehen könnten. Ein Beweis steht aber noch aus. Als mögliche Ursache werden Entzündungsprozesse im Gehirn im Zuge der Infektion angenommen.
Hinweise darauf, dass entzündungshemmende Mittel wie Ibuprofen das Demenzrisiko vermindern könnten, habe es ebenfalls schon zuvor gegeben, erläutern die Wissenschaftler um Underwood. Bekannt sei, dass einige Genvarianten, die mit einem höheren Demenzrisiko einhergehen, Teil von Entzündungswegen sind.
"Wirkstoffe, die auf entzündungshemmende Ziele abzielen, gehören zu den größten Kategorien in der Pipeline der Arzneimittelentwicklung für Alzheimer", heißt es in der Studie. Entscheidend könnte der Einsatz des richtigen Wirkstoffs zum richtigen Zeitpunkt des Krankheitsverlaufs sein, vielleicht vor der Ausprägung des kognitiven Abbaus, mutmaßen die Forschenden. Aus der Studie sei dazu allerdings nichts abzuleiten.
Vorsicht bei der Bewertung geboten
Günstig wirkt es sich der Auswertung zufolge zudem aus, wenn Bluthochdruck und Fettleibigkeit in der Lebensmitte behandelt würden. Auch bei anderen Mitteln etwa gegen Refluxkrankheit, Epilepsie, Asthma und einen hohen Cholesterinspiegel zeigte sich ein möglicher günstiger Zusammenhang - bei anderen ein negativer. Entsprechende Hinweise gebe es zum Beispiel bei antipsychotischen Medikamenten.
Bei der Bewertung sei jeweils Vorsicht geboten, betont das Team. "Nur weil ein bestimmtes Medikament mit einem erhöhten Demenzrisiko in Verbindung gebracht wird, heißt das nicht unbedingt, dass es Demenz verursacht oder sogar fördert", gibt Mitautorin Ilianna Lourida von der University of Exeter zum Beispiel zu bedenken. Bekannt sei etwa, dass Diabetes das Demenzrisiko erhöht. "Wer also Medikamente zur Regulierung seines Blutzuckerspiegels einnimmt, hat natürlich auch ein höheres Demenzrisiko - aber das bedeutet nicht, dass das Medikament das Risiko erhöht."
Was ist Ursache, was Wirkung?
Als weiteres Beispiel wird genannt, dass Antidepressiva mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für eine Demenzdiagnose verbunden zu sein scheinen. Sie würden aber häufig in frühen Stadien der Demenz verschrieben - es sei hier also die Demenz, die die Wahrscheinlichkeit erhöhe, Antidepressiva verschrieben zu bekommen, und nicht umgekehrt.
Für die erhaltenen Ergebnisse sei es unmöglich, die Richtung der Kausalität zu beurteilen, betonen die Wissenschaftler. Einschränkend geben sie zudem zu bedenken, dass die berücksichtigten Datensätze erhebliche Mengen an fehlenden oder falsch eingegebenen Daten enthalten könnten. Mögliche Wechselwirkungen zeitgleich eingenommener Medikamente blieben unberücksichtigt. Zudem könnten erhaltene Ergebnisse durch eine Untererfassung von Demenzen oder falsche Diagnosen ungenau sein.
"Obwohl die Ergebnisse für einzelne Medikamente nicht sofort eindeutig sind, haben sich einige erwartete und einige unerwartete Muster herauskristallisiert", schließen die Forschenden. Sie sind davon überzeugt, dass eine Untersuchung der Risikominderung durch bereits vorhandene Medikamente den traditionellen Ansatz der Arzneimittelsuche bei Demenzen sinnvoll ergänzen kann. Ihre Arbeit könne bei der Priorisierung von Kandidaten dafür helfen.