Die "Coronavirus-Geburtsstunde"Erste Infektionen womöglich schon im Oktober 2019
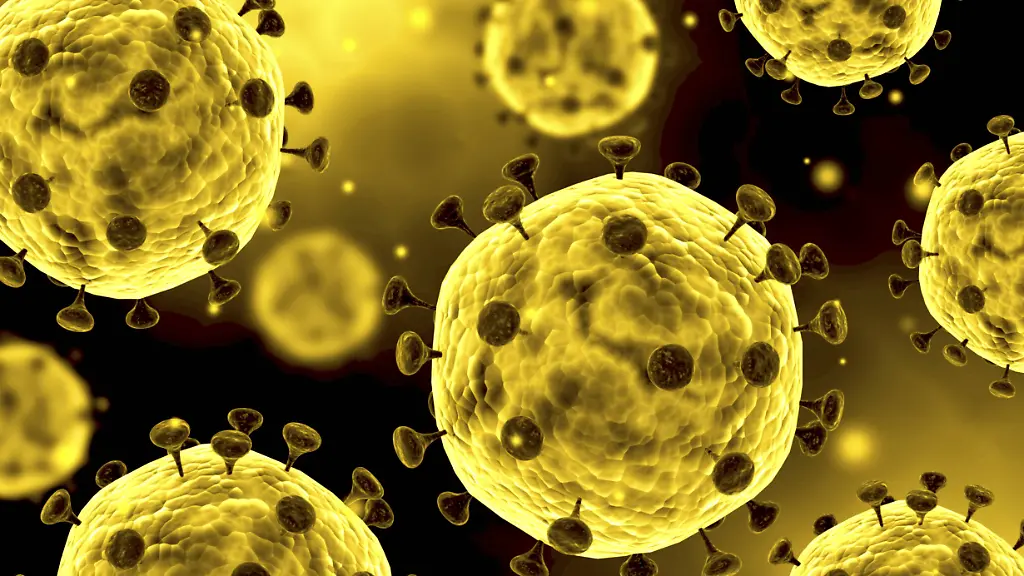
Der erste Fall eines Sars-CoV-2-Infizierten wird im Dezember 2019 festgestellt. Doch nun verdichten sich die Hinweise, dass das Virus schon deutlich früher auf den Menschen übergesprungen sein könnte. Zu diesem Schluss kommen Genetiker.
Genetiker weltweit legen besonderes Augenmerk auf die genetischen Veränderungen von Krankheitserregern, die sogenannten Mutationen. Sie sehen daran, wie sich die Erreger entwickeln und an ihre Umwelt anpassen. Im Laufe der Zeit verschwinden deshalb einige wieder, andere hingegen bleiben. Dem Forscherteam um Francois Balloux vom University College London (UCL) ist es mithilfe von Berechnungen nun gelungen, daran die "Geburtsstunde" des neuen Coronavirus abzulesen.
Die Forscher gehen aufgrund ihrer Ergebnisse davon aus, dass sich der erste Mensch oder die ersten Menschen zwischen dem 6. Oktober und dem 8. Dezember mit Sars-CoV-2 infiziert haben. Diesen Zeitraum, der sich laut Forscher nicht noch mehr eingrenzen lässt, könnte man auch als "Geburtsstunde" des Virus bezeichnen. China meldete den ersten Fall von Covid-19 der Weltgesundheitsorganisation am 31. Dezember 2019. Der Beginn der Pandemie könnte den Schätzungen der Forscher zufolge damit wesentlich zeitiger begonnen haben, schreiben die Forscher im Fachblatt "Infection, Genetics and Evolution".
7666 Genproben ausgewertet
Die UCL-Forscher benutzten für ihre Analysen insgesamt 7666 Genproben des Virus, die von mehr als 7500 Covid-19-Patienten gewonnen worden waren. Aus den zahlreichen Mutationen, die sie sahen, konnten insgesamt 198 ausgemacht werden, die mehrfach auftraten. Die Forscher wissen bereits, dass 80 Prozent aller Mutationen zu genetischen Veränderungen bei Viren führen. Bei Sars-CoV-2 sind vor allem Proteine oder Enzyme mit der Bezeichnung Nsp6, Nsp11, Nsp13 und dem sogenannten Spike-Protein beteiligt.
Den Forschern ist klar, dass zu diesem Zeitpunkt niemand genau sagen kann, welche Auswirkungen diese genetischen Veränderungen bei damit infizierten Menschen haben können. Dennoch gibt es Anzeichen und Erfahrungswerte, wonach beispielsweise ein verändertes Nsp6-Protein Einfluss auf die Immunreaktion haben könnte. Bei Nsp6 handelt es sich nämlich um einen Bereich, der von den T-Zellen des Immunsystems erkannt wird, schreibt das Deutsche Ärzteblatt in seiner aktuellen Ausgabe dazu. Die Mutation am Spike-Protein hingegen könne die Infektiosität des Virus beeinflussen, auch wenn sich die Veränderung außerhalb der speziellen Bindungsstelle, dem sogenannten ACE-Rezeptor, mit der das Virus an den menschlichen Zellen andockt, befindet.
Die Ergebnisse sind Anzeichen dafür, dass sich das Virus innerhalb von Monaten genetisch an den Menschen als seinen neuen Wirt angepasst hat. Gleichzeitig können sie bei der Entwicklung von wirksamen Medikamenten und sicheren Impfstoffen helfen.
Als Grundlage haben die Forscher auch auf die genetischen Daten bei Global Initiative on Sharing All Influenza Data, kurz Gisaid zurückgegriffen. Genetiker weltweit teilen ihre Daten auf dieser Plattform, auf der bis zum 7. Mai 2020 insgesamt 17.030 Genom-Analysen hochgeladen worden sind.