Zehn wichtigste ErkenntnisseDas müssen Sie über den Europawahl-Abend wissen
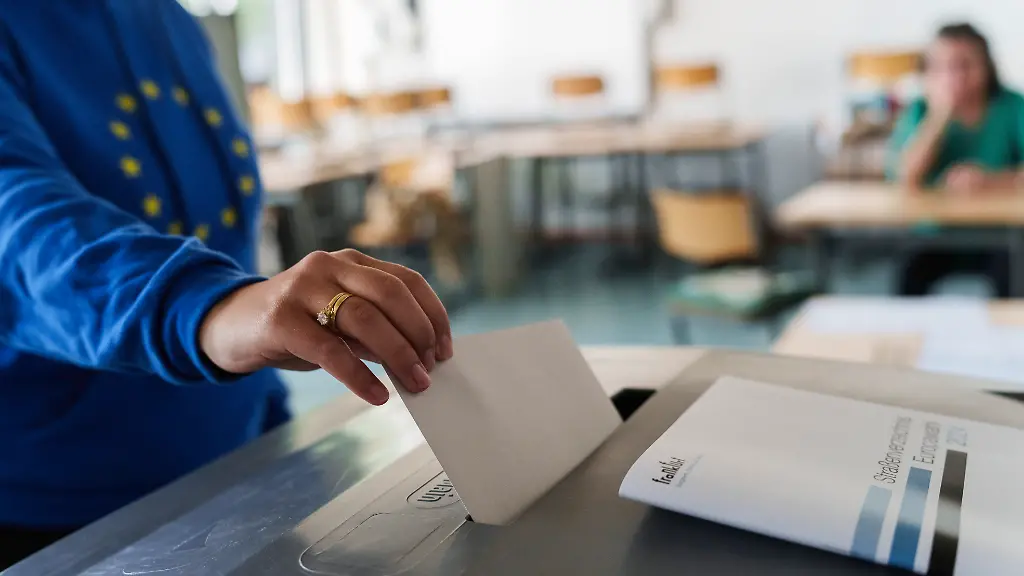
Dieser Europawahlabend bleibt im Gedächtnis: Fast jede Partei lässt sich als Gewinnerin oder Verliererin einsortieren, überall ist Bewegung. Für die Ampel hat die Wahl unmittelbare Folgen. Geht es nach Friedrich Merz: möglichst drastische. Ampel und Union haben aber gleichermaßen Grund zur Sorge.
Dieser Europawahlabend bleibt im Gedächtnis: Fast jede Partei lässt sich als Gewinnerin oder Verliererin einsortieren, überall ist Bewegung. Für die Ampel hat die Wahl unmittelbare Folgen. Geht es nach Friedrich Merz: möglichst drastische. Ampel und Union haben aber gleichermaßen Grund zur Sorge. ntv.de fasst die zehn wichtigsten Erkenntnisse des Wahlabends zusammen.
1. Haushalt wird noch schwieriger: Ampel ist nur geschäftsführend im Amt
Die ersten Hochrechnungen waren kaum draußen, da gingen führende Ampel-Vertreter bereits aufeinander los. Die SPD ist mit rund 14 Prozent mehr als zehn Prozentpunkte unter ihrem Bundestagswahlergebnis gelandet. Umgehend kündigte SPD-Chef Lars Klingbeil der FDP knallharte Haushaltsverhandlungen an. Deren Vorsitzender, Bundesfinanzminister Christian Lindner, dürfte sich durch die im Vergleich zu 2021 dennoch schwachen 5 Prozent für seine Partei bestätigt sehen. Er blieb jedenfalls bei seiner Linie, forderte vehement Sozialkürzungen und schloss jedwede Umgehung oder Lockerung der Schuldenbremse aus. Wie so ein mittleres zweistelliges Milliardenloch im kommenden Haushalt gespart werden soll, weiß niemand. Die tief zerstrittene Ampel kann sich höchstens noch durchwursteln bis zur Bundestagswahl 2025, vielleicht aber auch das nicht mehr.
2. Besonnenheit zieht nicht: Kaum jemand will diesen Kanzler
SPD-Spitzenkandidatin Katarina Barley war zu unbekannt. Die SPD plakatierte sie stattdessen mit dem Kanzler. Den präsentierte die Partei als Friedensgaranten für Deutschland und machte die Wahl so unweigerlich auch zur Abstimmung über Scholz. Das Ergebnis: katastrophal. Die SPD hat selbst bei vergleichsweise hoher Wahlbeteiligung massiv Stimmen verloren und bewegt sich wieder auf dem Tiefpunkt-Niveau der Jahre 2017 bis 2019. Die Union fordert Scholz auf, Neuwahlen einzuleiten. Doch die SPD hat nach dieser Wahl allen Grund, solche fürchten.
3. Triumph auf ganzer Linie: Merz nimmt Fahrt aufs Kanzleramt
Demoskopen und SPD-Politiker betonen häufig, dass CDU-Chef Friedrich Merz auch nicht gerade beliebt ist bei den Wählerinnen und Wählern. Umfragen zeigen tatsächlich immer wieder, dass das so ist. Aber es spielt keine Rolle: Die Union ist mit deutlichem Abstand Sieger der Europawahl. Ob sie besser abgeschnitten hätte, wenn der CDU-Vorsitzende ein anderer wäre, lässt sich nicht ermitteln. Es ist Merz, der die Union dorthin geführt hat, wo sie jetzt ist. Das Ergebnis hätte besser sein können, das ist klar. Aber nach aktuellem Stand heißt der nächste Bundeskanzler Friedrich Merz.
4. Krah-Chaos und hohe Wahlbeteiligung: AfD trotzdem starker Zweiter
Spionage-Skandal, SS-Verharmlosung, Russland-Nähe: Die AfD musste ihren Spitzenkandidaten Maximilian Krah im Wahlkampf verstecken. Der zweite auf der AfD-Kandidatenliste, Petr Bystron, mied die Öffentlichkeit freiwillig, weil ihm vorgeworfen wird, sich für Russlandpropaganda bezahlt haben zu lassen. Dazu die gerichtlich bestätigte Einstufung als rechtsextremistischer Verdachtsfall und die Verurteilung von Björn Höcke: Der AfD kann all das nichts anhaben. Mit rund 16 Prozent wird die Partei mit kleinem Vorsprung zweitstärkste Kraft. Die Parteiführung strotzt vor Freude, wird sich aber dennoch fragen: Was wäre mit weniger skandalträchtigen Spitzenkandidaten für sie drin gewesen?
5. 40 Prozent für AfD und BSW: Der Osten entfernt sich vom Rest
Die Ampelparteien kommen in den ostdeutschen Flächenländern und Berlin auf nur rund 20 Prozent. Schlimm genug, dass sich 80 Prozent der Wahlteilnehmer von den Regierungsparteien im Bund nicht vertreten fühlen. Dass aber 27 Prozent von ihnen die im Osten besonders offen rechtsradikale AfD wählen sowie weitere 13 Prozent das populistische Wagenknecht-Bündnis, spricht für eine tiefgehende Entfremdung vom Rest der Republik. Insbesondere der Umgang mit Russland dürfte diese Wahlentscheidungen motiviert haben. Eine Trendumkehr vor den Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen ist nicht abzusehen.
6. Mandate halbiert: Grüne sind der Wahlverlierer
Die allgemeine Stimmung für mehr Klimaschutz brachte den Grünen 2019 ein Rekordergebnis von 20,5 Prozent. Fünf Jahre später ist das Gegenteil der Fall. Die Grünen landen sogar noch deutlich unter ihren bisherigen Umfragewerten. Klimaschutz ist nicht mehr en vogue und unverdrossen klimabewegte Jüngere wenden sich Kleinparteien wie Volt zu. Es macht sich bemerkbar, dass die vielen Zugeständnisse im Ampelbündnis die Beziehungen der Grünen zu den vielen Umwelt- und Klimabewegungen beschädigt haben. Zugleich stehen die Grünen wieder ganz am Anfang ihrer Bemühungen, über das eigene Milieu hinaus Wähler zu gewinnen.
7. Europa rückt nach rechts
Wahlsiegerin in Frankreich ist Marine Le Pen, die ihre Partei schon seit Jahren "entteufelt": Aus dem rechtsextremen Front National wurde der rechtspopulistische Rassemblement National, der bei den Europawahlen ein Drittel der Stimmen einfuhr und doppelt so stark wurde wie Macrons Renaissance-Partei. In Österreich gewann die FPÖ, in den Niederlanden wurde die PVV von Geert Wilders zweitstärkste Kraft, in Italien siegten die Postfaschisten von Giorgia Meloni, die bisher allerdings in einer anderen, moderateren Fraktion sitzen als FPÖ und die Le-Pen-Partei. Was das für die Arbeit im Europaparlament bedeutet, muss sich erst noch zeigen: Die nationalistischen Parteien sind traditionell uneins, wie sie Europa umkrempeln oder bekämpfen wollen. Erst kurz vor der Wahl sorgte Le Pen dafür, dass die AfD aus der Rechtsaußen-Fraktion Identität und Demokratie geworfen wurde; auch dies ein Akt der "Entteufelung". Jetzt, nach der Wahl, hofft die AfD auf eine Versöhnung. "Mit diesem Rekordergebnis haben wir natürlich auch Rückenwind für unsere Verhandlungen", sagte AfD-Chef Tino Chrupalla am Wahlabend.
8. Macron und FDP: Die Liberalen schmieren ab
Rund 5 Prozent für die FDP sind ein Ergebnis, bei dem man als Liberaler schon mal erleichtert aufseufzen darf - das hätte auch schlimmer ausgehen können. Dennoch kann man das Ergebnis nur schönreden, wenn man es mit noch schlechteren Europawahlergebnissen der Vergangenheit vergleicht. Der Referenzpunkt sind jedoch die 11,5 Prozent der Bundestagswahl 2021. "Renew Europe", die Fraktion der Liberalen, wird deutlich kleiner sein als in den vergangenen fünf Jahren. Die Partei des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, bislang die größte Gruppe dieser Fraktion, ist abgestürzt. Noch am Wahlabend kündigte Macron an, die Nationalversammlung aufzulösen und so Neuwahlen einzuleiten.
9. Die Jugend wählt nicht links
Die Zahlen sind nicht direkt vergleichbar, weil 16-Jährige in Deutschland vor fünf Jahren noch nicht an der Europawahl teilnehmen konnten. Aber der Trend ist klar und passt ins Bild. 2019 wählten 30 Prozent der 18- bis 29-Jährigen die Grünen, auf Platz zwei folgte mit 13 Prozent die Union. Die Grünen lagen bei den Jungen damit noch über ihrem historischen Erfolgsergebnis von damals 20,5 Prozent. Das hat sich komplett gedreht: Nach vorläufigen Zahlen von Infratest Dimap wählten 17 Prozent der Jungwähler zwischen 16 und 24 die Union - und ebenso viele die AfD. Die Grünen kommen in dieser Altersgruppe nur auf 11 Prozent. Das ist noch weniger als sie insgesamt holten. Die SPD kommt bei den unter 25-Jährigen nur auf 9 Prozent. Grüne, SPD und Linke insgesamt holten 2019 bei den Jungen 46 Prozent. Jetzt kommen die drei Parteien unter den 16- bis 24-Jährigen auf 26 Prozent.
10. Die Kleinstparteien werden immer größer
Erfolgreichste Partei bei den 16- bis 24-Jährigen waren die "Anderen". Aber auch links des grauen Balkens, der Kleinparteien wie Volt und "Die Partei", die Tierschutzpartei, die Familienpartei und die ÖDP zusammenfasst, gibt es immer mehr Parteien. Seit den 1980er Jahren kommen in immer kürzeren Abständen immer neue Parteien dazu: erst die Grünen, die längst etabliert sind, dann die PDS, deren Erbe die Linke verwaltet, dann die AfD und zuletzt das Bündnis Sahra Wagenknecht. Fünf Fraktionen und zwei Gruppen sitzen aktuell im Bundestag, es könnten nach der nächsten Wahl noch mehr werden. Das hat Vorteile: Mehr Parteien bilden ein breiteres Meinungsspektrum ab. Es hat aber auch gravierende Nachteile: Nicht nur die Arbeit im Parlament wird schwieriger, auch die Bildung von Regierungen.