Opfer sollten sich wehrenUrteile zu Phishing - oft haftet die Bank
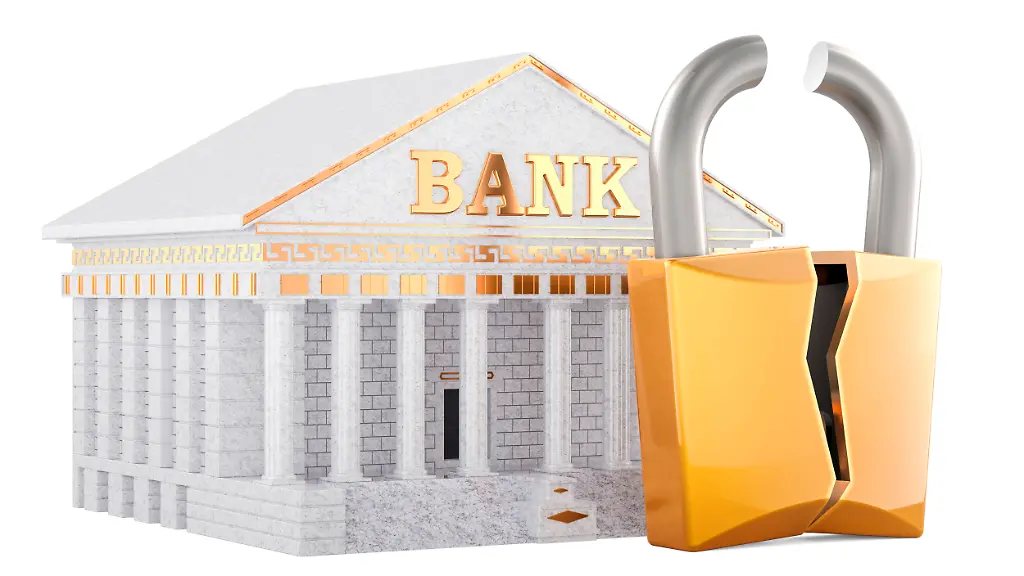
Identitätsklau, Phishing, Cyberkriminalität - immer mehr Menschen werden Opfer von Verbrechen im Internet. Wer trägt den Schaden? Viele Gerichte sagen: Die Bank muss zumindest einen Teil der Kosten übernehmen. Ein Überblick über aktuelle Urteile.
Je mehr elektronische Geräte und Online-Banking beim Einkaufen genutzt werden, desto größer wird die Gefahr, zum Opfer von digitalem Betrug zu werden. Doch dabei muss der Betroffene oft den Schaden nicht alleine tragen. Zumindest dann, wenn er sich nicht vorschnell von seiner Bank abwimmeln lässt und hartnäckig bleibt - notfalls mithilfe von Anwalt und Gericht. Denn die Justiz legt hohe Ansprüche an die Kontrollmechanismen von Banken.
Grundsätzlich gilt dabei: Die Bank ist verpflichtet, nicht vom Kunden autorisierte Transaktionen zu erstatten. Nur bei grober Fahrlässigkeit des Kunden kann sie die Zahlung verweigern. Häufig müssen die Kreditinstitute daher den Schaden ausgleichen - zumindest einen Teil davon. Das zeigt die aktuelle Rechtsprechung.
Landgericht Karlsruhe verurteilt Sparkasse (Az.: 2 O 312/22)
Hier hatten die Täter mithilfe von Datenklau einen Apple Pay Zugang des Opfers auf einem eigenen iPhone eingerichtet. Anschließend hatten sie bei insgesamt 122 Käufen einen Schaden von über 40.000 Euro angerichtet. Das Gericht verurteilte die Sparkasse, das Geld zu ersetzen, da der Kunde die einzelnen Transaktionen nicht selbst freigegeben hatte.
Urteil des Landgerichts Berlin zu Kleinanzeigen (Az.: 38 O 118/23)
Das Opfer trat als Verkäufer auf einem Kleinanzeigen-Portal auf. Der Täter gab vor, das angebotene Produkt kaufen zu wollen. Er verschickte einen Link zu einer Seite, welche der offiziellen Zahlungsseite des Portals täuschend ähnlich sah. Dort sollte der Verkäufer seine Kreditkartendaten eingeben, um die angebliche Zahlung des Betrügers zu erhalten. Das Gericht verurteilte die Bank zur Rückzahlung des Geldes, da der Kunde sich nur leicht fahrlässig verhalten habe.
Landgericht Aachen in Sachen Sparkasse (Az.: 10 O 53/23)
Hier muss eine Sparkasse die Hälfte des Schadens übernehmen, obwohl sich der Kunde laut Gericht grob fahrlässig verhalten hat. Er hatte den Anruf eines angeblichen Mitarbeiters der Bank erhalten, der ihm sagte, dass das TAN-Verfahren der Bank umgestellt werde. Der Betrüger leitete den Kunden auf eine gefälschte Webseite, wo dieser seine Daten eingab. In mehreren Transaktionen erbeuteten die Diebe daraufhin mehr als 100.000 Euro. Da die Bank das Konto nicht rechtzeitig gesperrt hat, muss sie sich zur Hälfte an dem Schaden beteiligen.
Landgericht Zweibrücken verurteilt Volksbank (Az.: 2 O 130/22)
Das Gericht verurteilte eine Bank zur Übernahme des gesamten Schadens, obwohl sich der Kunde grob fahrlässig verhalten hatte, als er seine Daten auf einer gefälschten Website eingab. Grund: Bank und Kunde hatten ein Überweisungslimit vereinbart, das von den Tätern zunächst erhöht wurde, bevor sie einen fünfstelligen Betrag überwiesen. Das hätte die Bank stutzig machen müssen, so das Gericht. Sie hätte die Transaktion stoppen müssen.
Tipp: hartnäckig bleiben!
Diese Beispiele zeigen, dass Verbraucher, die Opfer von Computerkriminalität werden, gute Chancen haben, ihre Bank an dem Schaden zu beteiligen. Nach unserer Erfahrung passiert das jedoch nur in seltenen Fällen freiwillig. Meist weisen die Banken zunächst eine Verantwortung zurück und argumentieren, der Kunde habe sich grob fahrlässig verhalten.
Das ändert sich häufig, wenn ein Anwalt und möglicherweise auch ein Gericht eingeschaltet werden. Denn in vielen Fällen ergeben sich bei näherer Betrachtung Hinweise darauf, dass die Banken ihrer Sorgfaltspflicht nicht vollständig nachgekommen sind. Die Gerichte stehen dabei häufig aufseiten der Verbraucher. Wer von einem Cyberbetrug betroffen ist, sollte daher hartnäckig bleiben und seine Aussichten von einem spezialisierten Anwalt prüfen lassen, beispielsweise kostenlos und unverbindlich bei der Interessengemeinschaft Widerruf.
Über den Autor: Roland Klaus ist Gründer der Interessengemeinschaft Widerruf. Sie hilft bei der Durchsetzung von Verbraucherrecht in Finanzfragen und wird dabei von spezialisierten Anwälten unterstützt.