Rasante EntwicklungKommt jetzt ganz schnell ein Impfstoff?
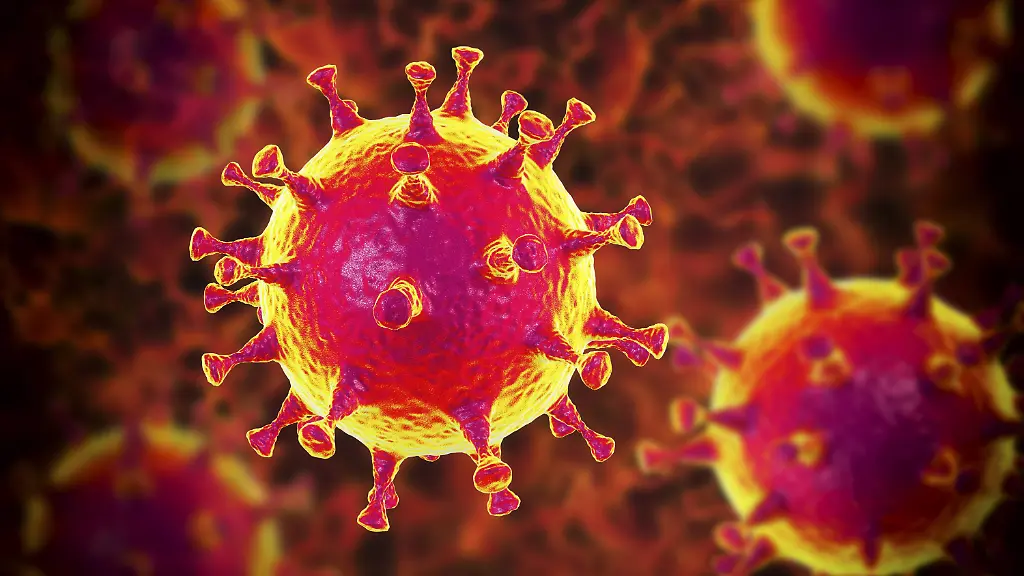
Die Entwicklung von Impfstoffen gegen Covid-19 schreitet rasant voran. Mehr als 20 potenzielle Vakzine werden schon an Menschen getestet, 2 davon sind in der letzten Phase der klinischen Studien. Das ist ermutigend, doch der Kampf gegen das Coronavirus ist damit noch lange nicht gewonnen.
Noch nie wurden Impfstoffe gegen Viruserkrankungen auch nur annähernd so schnell entwickelt wie gegen Covid-19. Normalerweise dauert es mehrere Jahre, bis ein wirksames Vakzin zugelassen wird. Bei Sars-CoV-2 erwarten Experten, dass bereits Mitte 2021 ein oder mehrere Impfstoffe in größerem Maßstab zur Verfügung stehen können, obwohl die Suche danach erst im Januar begonnen hat.
Fast 170 Impfstoff-Projekte
Aktuell zählt die WHO 166 Projekte, die an einem Impfstoff arbeiten. 24 von ihnen befinden sich bereits in klinischen Studien. Das heißt, die Mittel werden an Menschen getestet. Mindestens zwei Forschungen befinden sich sogar schon in der entscheidenden dritten Phase mit tausenden Probanden, in der sich im Alltag erweisen muss, ob ein Vakzin tatsächlich vor einer Covid-19-Erkrankung schützt. Der Corona-Alptraum endet deswegen im nächsten Sommer aber wohl noch nicht.
Wenn Mitte 2021 ein Impfstoff in Massenproduktion sein soll, muss es einer der 24 Kandidaten sein, die sich bereits in klinischen Studien befinden. Alle anderen sind nicht aus dem Rennen, aber selbst mit dem größten Aufwand könnten sie den Rückstand kaum aufholen, da bei der Entwicklung einige Schritte aus Sicherheitsgründen nicht ausgelassen werden können.
Briten liegen knapp vorne
Die Nase vorne hat aktuell das britische Projekt der Oxford-Universität und des Pharma-Konzerns Astrazeneca. Ihr Vakzin basiert auf einem Adenovirus, das bei Schimpansen Erkältungen auslöst, sich aber nicht im menschlichen Körper vermehren kann. Die Forscher nutzen es als Transportmittel für genetisches Material des Spike-Proteins, mit dem Sars-CoV-2 an Zellen andockt. So "lernt" das Immunsystem, sich gegen Covid-19 zu wehren.
So ein moderner Impfstoff ist wesentlich schneller massenhaft herzustellen als Vakzine, für die man das zu bekämpfende Virus erst vermehren muss, um es dann abgetötet oder abgeschwächt einzusetzen. Allerdings haben herkömmliche Impfstoffe den Vorteil, dass sie auch in Entwicklungsländern hergestellt werden können, die nicht über Hightech-Anlagen verfügen.
Dem britischen Medizin-Fachblatt "The Lancet" zufolge ergaben Versuche mit 1077 gesunden Menschen, dass der Wirkstoff "ChAdOx1" eine deutliche Immunreaktion hervorruft, die auch noch 56 Tage nach der Impfung feststellbar ist. Dabei scheint der Impfstoff gut verträglich zu sein, schlimmere Nebenwirkungen als Fieber, Kopf- oder Muskelschmerzen stellten die Forscher laut Oxford-Universität nicht fest.
T-Zellen zerstören infizierte Zellen
Wichtig ist, dass das Vakzin sowohl die Bildung von B-Zellen als auch von T-Zellen auslöst. Vereinfacht dargestellt: Während die B-Zellen spezifische Antikörper gegen das Virus produzieren, erkennen T-Zellen infizierte Zellen und zerstören sie. T-Zellen können aber auch das Immunsystem in Alarmbereitschaft versetzen und die Produktion von Antikörpern forcieren.
Die Ergebnisse seien ermutigend, sagt Sarah Gilbert, Co-Autorin der Oxford-Studie. Wie gut der Impfstoff Menschen vor Covid-19 beschützen kann, könne man aber erst nach der angelaufenen dritten Phase bewerten. Dafür sind die Forscher unter anderem nach Brasilien gegangen, wo die Pandemie wütet, da die Zahl der Infizierten in Großbritannien so gering ist, dass verwertbare Ergebnisse erst in vielen Monaten zu erwarten wären.
Das chinesische Projekt des Jiangsu Provincial Center for Disease Control and Prevention in Nanjing setzt bei seinem Vakzin auf ein modifiziertes menschliches Adenovirus als Träger für die Bauanleitung des Sars-CoV-2-Spike-Proteins. Der "Ad5" genannte Impfstoff rief bei insgesamt 508 Probanden ähnliche Reaktionen hervor wie der britische Wirkstoff. Bis zu 90 Prozent der Probanden entwickelten T-Zellen, fast 100 Antikörper gegen das Coronavirus. Auch die Nebenwirkungen waren ähnlich unangenehm, aber ungefährlich.
Deutsche Firmen setzen auf mRNA
Das deutsche Unternehmen Biontech geht mit seinem US-Partner Pfizer einen anderen Weg, der ebenfalls im nächsten Jahr zu einer Massenproduktion eines Covid-19-Vakzin führen soll. Ihr Kandidat "BNT162b1" ist ein mRNA-Impfstoff, der den genetischen Bauplan für das Sars-CoV-2-Spike-Protein in Lipid-Nanopartikel verpackt. In einer aktuellen Pressemitteilung schreibt Biontech, die Versuche mit 60 Probanden hätten gezeigt, dass der Impfstoff nicht nur zur Bildung von Antikörpern, sondern auch zu der von T-Zellen führt. Dies sei bereits bei sehr niedrigen Dosen der Fall.
Im späten Juli soll eine Studie mit bis zu 30.000 Probanden Klarheit über Sicherheit und Wirksamkeit des Impfstoffs bringen. Sollte sie erfolgreich verlaufen und der Impfstoff die behördliche Zulassung erhalten, planen die beiden Unternehmen, bis Ende 2020 bis zu 100 Millionen Impfstoffdosen und bis Ende 2021 möglicherweise mehr als 1,3 Milliarden Impfstoffdosen produzieren zu können.
Mit Curevac ist noch ein weiteres hoffnungsvolles deutsches Unternehmen im Rennen, das ebenfalls ein mRNA-Vakzin entwickelt. Es hat vor rund einem Monat mit den ersten klinischen Studien begonnen.
Dass es auch mit herkömmlichen Impfstoffen schnell gehen kann, zeigt der chinesische Pharma-Konzern Sinovac, der ebenfalls in Brasilien eine Phase-3-Studie begonnen hat. Rund 9000 Angestellte im dortigen Gesundheitswesen sollen laut Pressemitteilung mit "Picovacc" geimpft werden.
Zuvor teilte das Pekinger Unternehmen mit, eine Studie mit 743 Freiwilligen habe ergeben, dass der Impfstoff zur Bildung von Antikörpern führt und gut verträglich ist. T-Zellen erwähnt Sinovac nicht. Sebastian Ulbert vom Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie (IZI) sagt, chemisch abgetötete Viren hätten den Nachteil, dass sie nicht in Körperzellen eindringen können. Dadurch würden weniger Virus-spezifische T-Zellen gebildet. In bestimmten Fällen könne das aber mithilfe von Zusatzstoffen ausgeglichen werden.
Je mehr, desto besser
Die Vielzahl der Impfstoff-Projekte fördert nicht nur den Wettbewerb, sie ist für einen erfolgreichen Kampf gegen Covid-19 essenziell, ein Vakzin alleine wird nicht ausreichen, um die Corona-Pandemie zu besiegen. "Wir können nicht vorhersagen, welche dieser Impfstoffe funktionieren werden", sagt WHO-Chef-Forscherin Soumya Swaminathan. "Im Moment haben wir absolut keine Ahnung, welcher erfolgreich sein wird." Für die aktuell 24 Projekte in klinischen Studien heißt das: "Wenn wir annehmen, dass es eine zehnprozentige Chance für jeden der Impfstoff-Kandidaten gibt, erfolgreich zu sein, bedeutet das immer noch, dass ein oder zwei Impfstoffe erfolgreich sein könnten - vielleicht sogar mehr."
Der Ansatz der WHO sei, so viele Impfstoffversuche für so viele Kandidaten wie möglich zu unternehmen, um die Erfolgschancen zu steigern. "Das Interesse und die Investitionen sind sehr hoch, aber wir haben bestimmte Kriterien", sagt Swaminathan. "Es reicht nicht aus, 20 oder 30 Prozent der geimpften Menschen zu schützen - das wird diese Pandemie nicht beenden. Wir brauchen einen Impfstoff, der etwa 70 Prozent Schutz bietet und sicher ist."
Es wird wohl nicht schnell gehen
Auch Sebastian Ulbert warnt vor zu großem Optimismus: Der große Wurf werde bei den ersten Impfstoffen wahrscheinlich noch nicht dabei sein, erwartet er. So dürften die ersten Mittel nur bestimmten Gruppen zugutekommen, etwa jungen, gesunden Menschen. "Die Risikogruppen beim Corona-Virus, vor allem Senioren, sind auch am schwersten zu impfen. Ihr Immunsystem reagiert oft nicht so gut auf Impfungen. Bis alle erreicht werden können, werde es noch länger dauern", sagt Ulbert. Deshalb sei es gut, viele verschiedene Ansätze zu haben, sagt Swaminathan. "Verschiedene Plattformen können möglicherweise in unterschiedlichen Bevölkerungsuntergruppen - etwa älteren Menschen, schwangeren Frauen oder Kindern - besser funktionieren."
Aber selbst wenn es schon bald mehrere, verschiedene wirksame Vakzine in großen Mengen gibt, muss die Welt vermutlich noch länger mit Covid-19 klarkommen. Auch wenn mehrere Impfstoffe zur gleichen Zeit zur Verfügung stünden, könne es zehn Jahre dauern, bis eine weltweite Immunität gegen Sars-Cov-2 erreicht ist, sagt Biontech-Mitbegründer Ugur Sahin. "Ich gehe davon aus, dass wir mit diesem Virus erst durch sein werden, wenn mehr als 90 Prozent der Weltbevölkerung durch eine Infektion oder einen Impfstoff immunisiert wurden.