Deutschland hat es jetzt eiligLiefert Kernfusion die Energie der Zukunft?
 Von Klaus Wedekind
Von Klaus Wedekind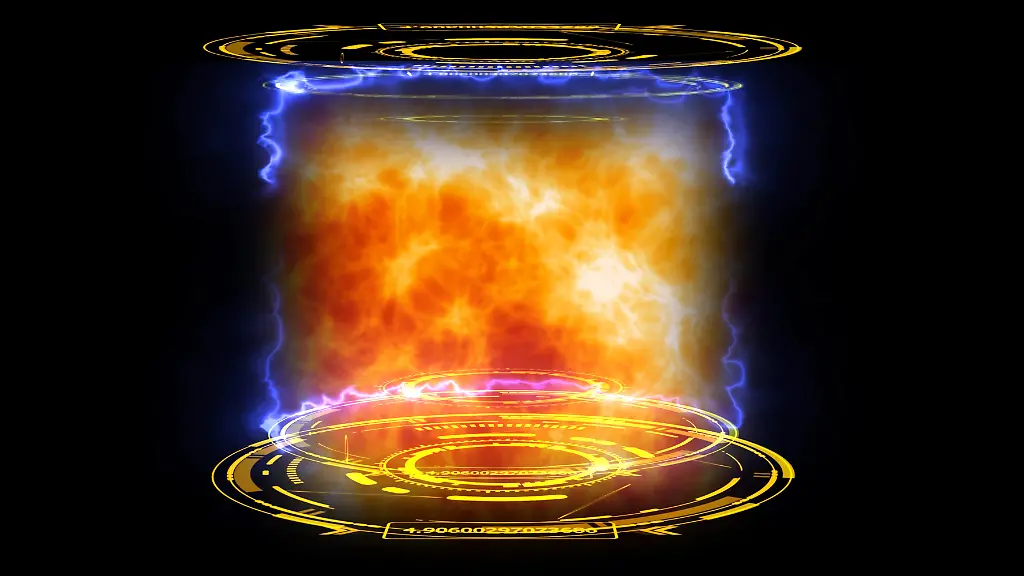
Die Bundesregierung will "schnellstmöglich" ein Fusionskraftwerk bauen und startet dafür ein neues Forschungsprogramm. Es sei eine "riesige Chance, all unsere Energieprobleme zu lösen", sagt Forschungsministerin Stark-Watzinger. Wissenschaftler bremsen die Euphorie, sehen aber große Zukunftschancen für die Technologie.
Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger hat am Mittwoch das Programm "2040 - Forschung auf dem Weg zum Fusionskraftwerk" vorgestellt. Es zielt unter anderem darauf ab, "schnellstmöglich" ein Fusionskraftwerk in Deutschland zu bauen, wie es der Titel schon vermuten lässt. Man wolle ein Fusionsökosystem aus Industrie, Startups und Wissenschaft aufbauen, um die vorhandenen Stärken Deutschlands zu bündeln und Synergien zwischen den unterschiedlichen Akteuren zu schaffen, sagt Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger von der FDP. "Das weltweite Rennen läuft. Ich möchte, dass wir in Deutschland unter den Ersten dabei sind, die ein Fusionskraftwerk bauen."
Fusion sei "die riesige Chance, all unsere Energieprobleme zu lösen", schwärmt die Ministerin. Grundsätzlich hat sie damit recht. Mit Kernfusion kann man theoretisch unendlich viel und relativ saubere Energie erzeugen. Es ist also genau die Technologie, die die Welt jetzt benötigt, um den Klimawandel aufzuhalten. Tatsächlich gab es bei der Verschmelzung von Wasserstoff-Atomkernen bei extrem hohen Temperaturen in jüngster Zeit beeindruckende Fortschritte. So gelang es im Dezember 2022 US-Forschern erstmals, mit einem Fusionsprozess mehr Energie zu erzeugen, als sie hineinsteckten. Vor wenigen Wochen feierten britische Wissenschaftler einen "Weltrekord" bei der Energiegewinnung durch Kernfusion.
30 Jahre bis kommerzieller Einsatz möglich ist
2040 dürfte aber trotzdem kein realistisches Datum für die Inbetriebnahme des ersten deutschen Fusionskraftwerks sein. Das Forschungszentrum Jülich geht in einer Stellungnahme für den nordrhein-westfälischen Landtag davon aus, dass von der Entscheidung für den Bau eines "Demonstrationskraftwerks" bis zur Inbetriebnahme rund 20 Jahre ins Land gehen dürften. Kommerzielle Fusionsanlagen, die beispielsweise 5 bis 10 Prozent Grundlast liefern könnten, sieht das Forschungszentrum erst in etwa 30 Jahren.
Selbst wenn das gelingt, sei ein Erfolg der Kernfusion nicht garantiert. Es gäbe noch keine Konzeptstudie für ein kommerzielles Fusionskraftwerk und keine verlässlichen Schätzungen der Investitionskosten für ein Fusionskraftwerk oder der Kosten für den durch die Fusion erzeugten Strom, so die Stellungnahme. "Daher ist es verfrüht zu behaupten, dass durch Fusion erzeugter Strom mit erneuerbaren Energien wettbewerbsfähig sein wird."
Emissionen müssen jetzt reduziert werden
Ähnlich zurückhaltend äußert sich Jan Wohland. Er ist Klimaforscher an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETHZ). "Wir müssen jetzt Emissionen reduzieren, um den Klimawandel aufzuhalten", sagt er. "Angesichts der begrenzten Fortschritte in der Kernfusion in der Vergangenheit erscheint es mir sehr unwahrscheinlich, dass Kernfusion in den nächsten Jahrzehnten nennenswert zu unserer Energieversorgung beitragen wird."
Das ist allerdings alles andere als eine Aufforderung, nicht in die Technologie zu investieren. Denn falls Kernfusion eines Tages verlässlich funktioniere, könne sie ein "Game-Changer für CO2-neutrale Energiesysteme sein, sagt Wohland. "Im Gegensatz zu Erneuerbaren gäbe es dann keine Wetterabhängigkeit in der Erzeugung. Kernfusion würde damit einige der Herausforderungen lösen, die beim Übergang zu Netto-Null existieren."
Langfristig könnte Kernfusion die ideale Lösung sein
Klaus Hesch hält wie seine Jülicher Kollegen einen Zeitrahmen von 20 Jahren bis zu einem funktionierenden Demonstrations-Kraftwerk "bei einem sehr ambitionierten und entsprechend mit Ressourcen ausgestatteten Programm" für realistisch. Er leitet das Fusionsprogramm des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT), versichert aber, rein sachlich zu argumentieren.
Hesch hält es für "ausgesprochen dumm", ausschließlich auf Deutschland zu blicken. Die Energiewende funktioniere - wenn überhaupt - nur weltweit, ist er überzeugt. Und der Energiebedarf werde global auch in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts weiter stark ansteigen. "Man kann angesichts des Flächenbedarfs nicht davon ausgehen, alles mit Windenergie und Fotovoltaik zu decken – selbst Indien, wo die Voraussetzungen für Sonnenenergie optimal sind, setzt auf Fusion", sagt er.
Ihm fehlt bei der Diskussion außerdem der Aspekt der Energie-Unabhängigkeit. Mit dem Versuch, grünen Wasserstoff aus Übersee einzukaufen, ersetze man die Abhängigkeit vom russischen Gas lediglich durch eine andere. Langfristig sei das keine Lösung, ist Hesch überzeugt. "Wir bleiben verletzlich, nicht nur wegen der Abhängigkeit vom guten Willen der Lieferanten, sondern auch wegen der Transportwege. Genau hier bietet die Fusion die benötigte Lösung."