Labore und Ämter am LimitCorona-Test-Strategie geht nicht mehr auf
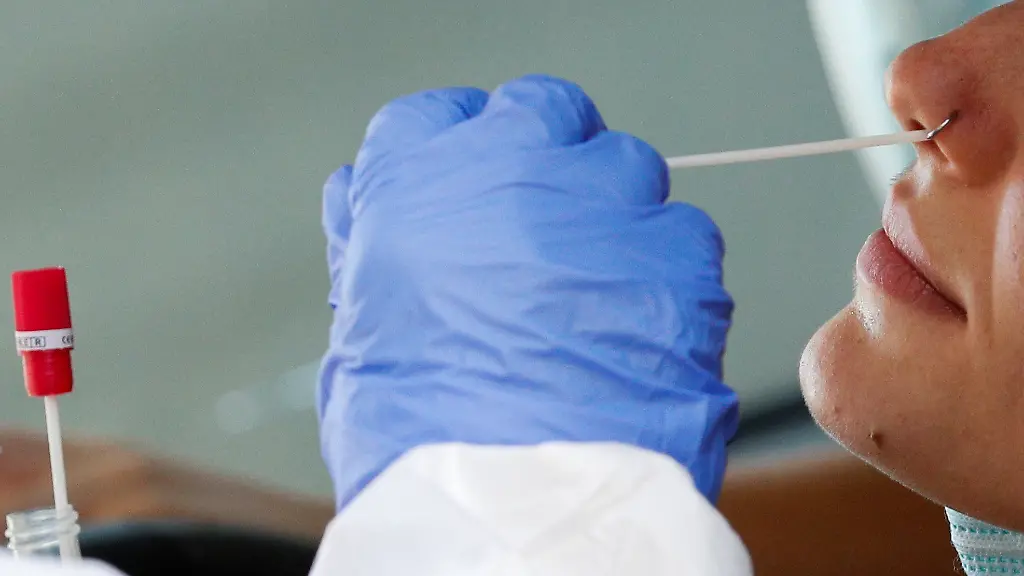
In Deutschland werden wöchentlich bereits mehr als eine Million Corona-Tests-durchgeführt und durch die rasant steigenden Neuinfektionen wächst der Bedarf weiter. Doch schon jetzt arbeiten Labore und Gesundheitsämter am Limit, manche sind schon darüber hinaus. So kann es nicht weitergehen.
"Testen ist essenzieller Bestandteil einer umfassenden Pandemie-Bekämpfungs-Strategie", schreibt das Robert-Koch-Institut (RKI). Die damit ermöglichte schnelle und präzise Erfassung der Zahl und Verteilung trage zu einem aktuelleren und besseren Lagebild bei. "Dies ist Grundlage für eine Unterbrechung von Infektionsketten und für einen Schutz vor Überlastung unseres Gesundheitssystems." Das war für die erste Phase der Corona-Pandemie sicher richtig, doch inzwischen hat sich die Lage entscheidend geändert und die deutsche Test-Strategie geht so nicht mehr auf.
So heißt es auf der RKI-Seite zur nationalen Test-Strategie zwar, die Kapazitäten seien seit März kontinuierlich erweitert worden, mehr als eine Million PCR-Tests könnten wöchentlich durchgeführt werden. Daher gäbe es in Deutschland keine Engpässe. Doch der Text wurde zuletzt am 12. August aktualisiert. In seinem Lagebericht vom 7. Oktober schreibt das RKI, es könne bei Verbrauchsmaterialien und Reagenzien in den Laboren in den nächsten Wochen zu Engpässen kommen. Dies liege an einer weltweit steigenden Nachfrage und an Abhängigkeiten von einzelnen Herstellern. Das hat Konsequenzen - und zwar schon jetzt.
Berliner Labore am Limit
So warnt die Fachgemeinschaft "Akkreditierte Labore in der Medizin" (ALM) laut RBB bereits vor einer Überlastung der Testlabore in Berlin. In der Woche bis zum 4. Oktober seien rund 52.500 Corona-Tests analysiert worden, die Kapazität liege bei 55.080 Proben, sagt ALM-Geschäftsführerin Cornelia Wanke. "Die Labore arbeiten im Moment am Limit, um die Ergebnisse möglichst schnell zu liefern", sagt sie. Sollte die Zahl der eingesendeten Proben in Berlin in den kommenden Wochen weiter zunehmen, drohten erste zeitliche Verzögerungen bei der Ermittlung der Befunde.
Neben den stark ansteigenden Infektionszahlen liegt der Ansturm auf Corona-Tests auch an den bevorstehenden Herbstferien in Berlin. Gestern wurde ein bundesweites Beherbergungsverbot für Menschen aus Risikogebieten beschlossen, zu denen bereits vier Bezirke der Hauptstadt gehören. Ein fünfter folgt in Kürze, auch Berlin als Ganzes hat die 7-Tage-Inzidenz von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen überschritten.
Neuinfektionen führen zu Test-Rückstau
Ähnlich dürfte es auch anderswo in Deutschland aussehen, vor allem in Ballungsgebieten. So schreibt das RKI, der Rückstau an PCR-Proben habe seit Anfang August stark zugenommen. Vergangene Woche meldeten 32 von 168 Laboren insgesamt 8245 Proben, die noch abzuarbeiten waren. In 32 Fällen wurden Lieferschwierigkeiten für Reagenzien als Grund genannt. In den Wochen zuvor waren die Zahlen - offenbar durch Reiserückkehrer - mit mehr als 30.000 angestauten Tests teilweise noch drastisch höher. Dabei kommt erschwerend hinzu, dass bei Fällen wie Reiserückkehrern, bei denen die Infektion erst kürzlich geschehen sein könnte, ein zweiter Test nötig ist. Denn frühestens drei, durchschnittlich erst nach fünf Tagen zeigt eine PCR-Probe eine Erkrankung an.
Angesichts der aktuell sprunghaft ansteigenden Neuinfektionen, die zwangsweise mehr Tests nach sich ziehen, wird die Luft nach oben immer dünner und voraussichtlich werden mehr Labore immer öfter Proben nicht mehr schnell genug abarbeiten können. Seit Mitte August wurden in Deutschland in jeder Woche mehr als eine Million PCR-Tests durchgeführt, zum Höhepunkt Ende September wurden fast 1,2 Millionen Proben in die Labore geschickt.
Theoretisch ist das kein Problem, denn die Testkapazität pro Tag ist in Deutschland auf zuletzt rund 232.000 Proben gestiegen, was 1.624.000 Proben pro Wochen entspricht. Doch in der Realität ist die Kapazität geringer, da nicht alle Labore sieben Tage die Woche in Betrieb sind. Aus den Angaben der Einrichtungen zu ihren Arbeitstagen errechnete das RKI eine wöchentliche Kapazität von etwa 1,5 Millionen.
Gefährliche Verzögerungen
Da die Kapazitäten nicht gleichmäßig verteilt sind, sind in einigen Regionen wie Berlin die Reserven schon fast aufgebraucht, während in weniger betroffenen und/oder weniger dicht besiedelten Gebieten die Test-Lage noch relativ entspannt ist.
Mit steigenden Proben-Zahlen verlängerten sich die durchschnittlichen Bearbeitungszeiten, "mit möglichen Konsequenzen für die zeitnahe Mitteilung des Ergebnisses an die betroffenen Personen sowie einem größeren Verzug bei der Meldung an das Gesundheitsamt", schreibt das RKI. Die Folgen sind gravierend. Denn dies kann laut der Behörde "mit Nachteilen für eine zeitnahe Abklärung von Sars-CoV-2-Infektionen und Einleitung von Infektionsschutzmaßnahmen durch die Gesundheitsämter einhergehen."
Was das bedeutet, sieht man wiederum am Beispiel Berlin. Dort sind einige Gesundheitsämter offenbar schon jetzt überlastet, was für die betroffenen Bürger hart und ärgerlich ist, aber auch zu einem Teil das Infektionsgeschehen in der Hauptstadt antreibt. Der "Tagesspiegel" hat das Berliner Chaos an Beispielen aus Charlottenburg und Kreuzberg veranschaulicht.
Gesundheitsämter teilweise bereits überfordert
So versuchte ein Kreuzberger, der nach seinem Urlaub auf den Kanaren positiv getestet worden war, vergeblich, mit dem Gesundheitsamt Friedrichshain-Kreuzberg Kontakt aufzunehmen, nachdem dieses sich nicht bei ihm gemeldet hatte. "Anrufe nahm niemand entgegen, E-Mails blieben unbeantwortet", schreibt der "Tagesspiegel". Erst fünf Tage nach dem positiven Befund hat die Behörde angerufen. Weitere sechs Tage später wurde er darüber informiert, dass seine Quarantäne bald ende. Nachfragen, eine Prüfung seiner Kontakte oder eine Suche nach weiteren Infizierten habe es nicht gegeben, so der Betroffene.
Bei seiner Freundin aus Lichtenberg lief das komplett anders, bei ihr rief das Amt täglich an, obwohl sie negativ getestet worden war. Das mag daran liegen, dass in Lichtenberg die Bundeswehr aushilft, während Friedrichshain-Kreuzberg dies mit dem Hinweis auf eine schleichende Militarisierung ablehnte.
Doch auch mithilfe der Bundeswehr geht es wohl in einigen Berliner Gesundheitsämtern manchmal drunter und drüber, beispielsweise in Charlottenburg. Dort werde offenbar "auf Personal zurückgegriffen, das die eigene Corona-Verordnung nicht ganz versteht", so der "Tagesspiegel". Die Vermutung liegt nahe. Denn in Charlottenburg musste eine Kita-Erzieherin zur Arbeit erscheinen, weil ihr das Gesundheitsamt nicht attestieren wollte, dass sie zu Hause in Quarantäne bleiben muss. Ihr Mann, ein Gastronom, hatte erfahren, dass einer seiner Mitarbeiter an Covid-19 erkrankt ist. Er isolierte sich sofort freiwillig und bekam drei Tage später trockenen Husten, ihm war heiß und er war schläfrig. Doch erst sechs Tage später wurde er getestet, vier Tage danach kam sein positives Ergebnis.
Als der Mann die deutlichen Symptome zeigte, hätte seine Frau in Quarantäne gehen müssen. Davor nicht, denn ansonsten müssen dem zuständigen Stadtrat zufolge nur Erstkontakte in Quarantäne. Er ist zufrieden. Sein Gesundheitsamt habe es bisher geschafft, alle Infektionsketten nachzuverfolgen. Allerdings arbeite man am Limit und die Testkapazitäten in den Laboren würden langsam knapp.
PCR-Ressourcen müssen effizienter eingesetzt werden
Das RKI hat erkannt, dass Handlungsbedarf besteht. Es erscheine "geboten, den Einsatz der Teste im Hinblick auf den angestrebten Erkenntnisgewinn in Abhängigkeit freier Testkapazitäten zu priorisieren", schreibt es. Damit folgt die Behörden den Forderungen von Experten wie Karl Lauterbach. Angesichts des Test-Staus durch die Reiserückkehrer empfahl er Ende August, Prioritäten zu setzen. Das RKI müsse neue Empfehlungen für die Gesundheitsämter vorbereiten, die sich auf die Bekämpfung von Corona-Clustern konzentrieren, twitterte er. "Es ist sicher falsch, den Herbst alleine mit Standard-PCR-Tests durchtesten zu wollen. Dazu reichen die Kapazitäten nicht."
Auch Virologe Christian Drosten möchte, dass man in Deutschland davon abkommt, mühsam Kontakte von Infizierten zu suchen und dann vielleicht viel zu spät und oft unnötig zu testen. Stattdessen fordert er eine Rückwärtssuche nach dem Ausgangspunkt großer Ausbrüche, den sogenannten Superspreadern. Wenn man Kontakte vorwärts verfolge, finde man viele Personen, von denen die meisten sich nicht angesteckt haben, sagt er.
Schnelltests sollen PCR-Tests ergänzen
Grundsätzlich ist das PCR-Verfahren für Massentests ungeeignet. Sie sind zu aufwendig, zu teuer und zu langsam. Daher sollten sie nach Ansicht von Spezialisten wie die Virologin Sandra Ciesek vor allem bei Patienten mit Symptomen eingesetzt werden. Doch in den kommenden Monaten sind auch Tests nötig, die unkompliziert schnelle Ergebnisse liefern und günstig genug für den massenhaften Einsatz geeignet sind - beispielsweise um Schulen und Pflegeeinrichtungen abzusichern oder Veranstaltungen ohne allzu große Auflagen zu ermöglichen.
Um mit den erschöpften PCR-Ressourcen effizienter umzugehen, kann man für Massentests ein sogenanntes Pooling machen. Dabei wird nicht jeder Test einzeln im Labor geprüft, sondern mehrere Proben einer identifizierbaren Gruppe gemeinsam ausgewertet. Fällt der Test negativ aus, sind alle negativ. Bei einem positiven Ergebnis geht die gesamte Gruppe für eine Woche in Quarantäne, ohne Zeit und Ressourcen durch weitere Tests zu verschwenden.
Heimtests wohl nicht mehr in diesem Jahr
Vor allem aber müssten möglichst bald Antigen-Schnelltests in Deutschland zum Einsatz kommen, die neben Lauterbach auch viele Virologen und Epidemiologen fordern. Mehrere sind in der Entwicklung oder stehen sogar kurz vor ihrer Zulassung. Auch Christian Drosten arbeitet an der Charité an solchen Schnelltests beziehungsweise evaluiert sie. Sie seien zwar nicht perfekt, weil sie "nicht ganz so empfindlich und genau sind wie die bislang üblichen PCR-Tests", sagte er in seinem NDR-Podcast. "Aber die Antigen-Tests haben einen riesigen Vorteil: Sie sind sehr schnell und vor Ort verfügbar. Was nützt mir ein PCR-Test, der sehr empfindlich ist, aber auf dessen Ergebnis ich drei, vier Tage warten muss, weil die Labore überlastet sind?"
Das Bundesgesundheitsministerium hat die Bedeutung von Antigen-Tests erkannt und daher kürzlich auch eine FAQ-Seite eingerichtet. "Wir möchten gern den Schnelltest zu einem Baustein machen", sagt Gesundheitsminister Spahn. Er ist auch optimistisch, dass es "in absehbarer Zeit" Heimtests gibt, sieht aber mit den vorerst knappen Kapazitäten zunächst in erster Linie einen Einsatz bei Besuchern und Beschäftigten von Pflegeheimen sowie generell im Gesundheitssektor.