Ausgebremste AntikörperMachen neue Mutanten Impfungen wirkungslos?
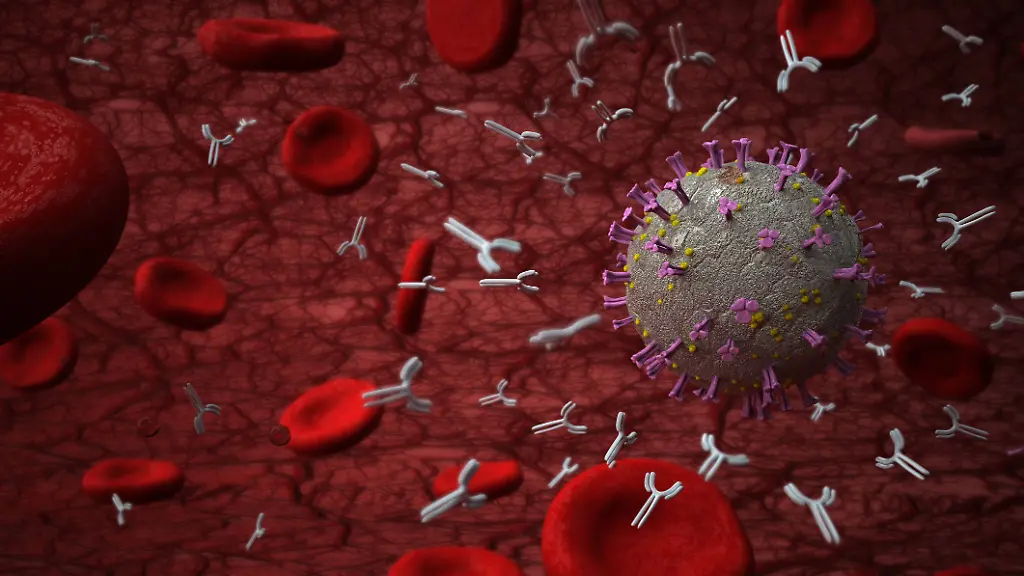
Virus-Mutanten breiten sich in Deutschland aus und die Sorge wächst, die bisher eingesetzten Impfstoffe könnten gegen eine von ihnen wirkungslos sein. Speziell die "südafrikanische Variante" B.1.351 scheint Antikörper ins Leere laufen zu lassen. Wie groß ist das Problem?
Während in Deutschland erst etwas mehr als 7 Prozent der Bevölkerung ihre erste Dosis erhalten haben und nur rund 3 Prozent vollständig geimpft sind, wächst zunehmend die Sorge, dass die Vakzine gegen kommende Virus-Mutanten teilweise wirkungslos sein könnten.
Besonders die im vergangenen Dezember in Südafrika entdeckte Variante B.1.351 ist offenbar in der Lage, Antikörpern zu entkommen. Darauf weisen inzwischen mehrere Vorab-Studien hin. Doch Antikörper sind nur ein Teil der Immunantwort und auch bei den Impfstoffen tut sich etwas.
Mutationen keine Überraschung
Dass Sars-CoV-2 mutiert, ist keine Überraschung. Es gehört zu den RNA-Viren, die sich sehr schnell verändern. Denn sie nutzen zur Replikation ein eigenes Enzym (Polymerase), das viele Fehler bei der Kopie des Erbguts produziert. Das Coronavirus mutiert allerdings langsamer als andere RNA-Viren, da es ein zweites Enzym zur Korrektur einsetzt.
Die entscheidenden Mutationen des Coronavirus finden an seinem Stachel-Protein (Spike-Protein) statt, mit dem es am ACE2-Rezeptor von Zellen andockt. Grundsätzlich sind zwei verschiedene Arten von Mutationen relevant. Eine ermöglicht eine einfachere Anbindung, was das Virus ansteckender macht. Die andere verhindert, dass Antikörper beim Andocken in die Quere kommen.
B.1.351 weist zum einen die Mutation N501Y auf, die die Infektiosität der Variante im Vergleich zum Virus-Wildtyp dramatisch erhöht. Man weiß das, da B.1.1.7, die auch in Deutschland innerhalb von Wochen zur dominanten Variante wurde, die gleiche Mutation aufweist. Einer Analyse der London School of Hygiene and Tropical Medicine zufolge hat sich die Variante in England um 77 Prozent ansteckender erwiesen.
Reduzierte Antikörper-Wirkung
Die für die Wirkung von Impfstoffen problematische Mutation hat die Bezeichnung E484K. Sie heißt so, weil sie sich in der betreffenden Stelle des Virus-Genoms befindet, der Rezeptorbindungsdomäne (RBD). Dort hätten Mutationen den größten Effekt auf die Antikörper-Bindung und Neutralisation, schreibt Allison Greaney, die ein Forschungsprojekt der University of Seattle leitet. In ihren Versuchen mit Blutseren genesener Covid-19-Patienten verringerte die E484K-Mutation die Wirkung der Antikörper um das Zehnfache. Ein Preprint der Columbia University in New York kommt zu einem ähnlichen Ergebnis.
Neben N501Y und E484K weist die Mutante B.1.351 in der RBD eine weitere Mutation auf, die einer Vorab-Studie der Universität von El Paso zufolge ebenfalls die Wirkung von Antikörpern einschränken kann: K417N/T. Möglicherweise ist auch die Kombination von Mutationen entscheidend.
Aktuell verursacht eine kürzlich publizierte Vorab-Studie der Bostoner Harvard Medical School Wirbel, da sie SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach mit dem Kommentar teilte, er fürchte, es könnten Mutationen entstehen, gegen die man nicht impfen könne.
Die Bostoner Wissenschaftler testeten die Wirkung der Impfstoffe von Biontech und Moderna anhand von Blutproben von 99 Personen, die jeweils eine oder zwei Dosen des Vakzins erhalten hatten. Zum Einsatz kamen keine echten Coronaviren, sondern im Labor erzeugte Pseudoviren.
Noch keine Fluchtmutation
Im Prinzip bestätigt die Bostoner Vorab-Studie weitgehend die vorangegangenen Forschungen. Sie zeigt, dass beide mRNA-Vakzine gegen den Virus-Wildtyp und B.1.1.7 so gut wirken, dass bereits eine Dosis einen hohen Schutzgrad erzielt. Andere Mutanten neutralisieren die Impfstoffe weniger effektiv, aber immer noch gut. Bei der Variante B.1.351 ist eine Dosis nicht mehr wirksam und auch mit der zweiten entsteht nur ein recht schwacher Schutz. Um Fluchtmutationen, mit denen das Virus durch eine Immunantwort überhaupt nicht mehr beeinträchtigt wird, handelt es sich allerdings noch nicht.
Auch was die eingeschränkte Wirksamkeit betrifft, sollte man aus Laborversuchen keine voreiligen Schlüsse ziehen. Das Ergebnis ihrer Arbeit bedeute nicht, dass Impfstoffe oder eine natürliche Immunantwort wie im Versuch auf das Virus nun zehn Mal weniger wirksam sind, schreibt Allison Greany. Denn die meisten Menschen produzierten Antikörper nicht nur gegen eine Stelle des viralen Proteins, sondern gegen mehrere verschiedene. So habe es Proben gegeben, die von der E484-Mutation kaum beeinträchtigt gewesen seien.
Viel hilft viel
Biontech und Pfizer haben wie die Forscher der Bostoner Harvard Medical School ihren Impfstoff anhand von Pseudoviren auf seine Wirksamkeit gegen Mutanten getestet. Dabei habe sich herausgestellt, dass die Neutralisierung des Virus mit der Mutation E484K zwar "etwas geringer" sei, heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung der beiden Unternehmen. Dies führe aber "vermutlich nicht zu einer signifikant verringerten Wirksamkeit des Impfstoffs". Biontech-Chef Ugur Sahin weist außerdem darauf hin, eine Erhöhung der Antikörper-Konzentration (Titer) könne die Wirkung des Vakzins erhöhen.
Ein Preprint der Icahn School of Medicine at Mount Sinai kam zu ähnlichen Resultaten bei Versuchen mit Blutproben geimpfter Personen. Die Forscher vermuten, dass ein ausreichend starker Schutz erst nach der zweiten Dosis erreicht wird und raten daher von Überlegungen ab, die Impfungen aus Mangel auf eine Dosis zu reduzieren.
Auch beim Impfstoff von Moderna führt die E-484K-Mutation dazu, dass er gegen die Variante B.1.351 nicht so stark wirkt wie gegen das ursprüngliche Virus - laut einer Vorab-Studie des Herstellers sechs Mal schwächer. In einer Stellungnahme schreibt Moderna, man erwarte, dass der Antikörper-Wert (Titer) trotzdem hoch genug sei, um auch Schutz vor der neuen Variante zu bieten. Es könne allerdings sein, dass eine Immunität früher nachlasse.
T-Zellen sind auch noch da
Eine Infektion kann so wahrscheinlich nicht vermieden werden, aber ein schwerer Verlauf der Krankheit. Das liegt nicht unbedingt an den Antikörpern. Denn zur Immunantwort gehören auch T-Zellen (Killerzellen), die befallene Zellen anhand von Virus-Bruchstücken erkennen, die sich auf ihrer Außenseite zeigen.
Auf die Abwehr durch T-Zellen dürfte die Mutation überhaupt keine Auswirkung haben. Folgeuntersuchungen von Probanden nach einer Studie des Universitätsklinikums Tübingen hatten ergeben, dass auch sechs Monate nach einer Infektion diese weißen Blutkörperchen noch stark auf Sars-CoV-2 antworteten.
Michael Nussenzweig von der New Yorker Rockefeller-Universität berichtete dem Deutschlandfunk von einem Symposium Anfang März, an dem auch Biontech-Chef Sahin teilnahm. Dieser habe von Studien mit dem Impfstoff berichtet, bei denen schon 14 Tage nach der ersten Dosis ein relevanter Schutz erzielt worden sei. Zu diesem Zeitpunkt hätte sich noch kein großer Antikörperspiegel aufgebaut haben können, so Nussenzweig. "Dies waren die Killerzellen, die demnach sehr effektiv sind. Und deshalb gingen eigentlich alle Forscher auf dem Symposium davon aus, dass die neuen Virus-Varianten geimpfte Personen zwar vielleicht infizieren können, dass es aber unwahrscheinlich ist, dass das bei vielen zu einem schweren Krankheitsverlauf führt."
Astrazeneca auch nicht nutzlos
Hinter dem Vektor-Impfstoff von Oxford-Astrazeneca gibt es bezüglich der Wirkung gegen B.1.351 noch ein größeres Fragezeichen. Weil eine Vorab-Studie der Johannesburger Wits Vaccines and Infectious Diseases Analytics (VIDA) zu dem vorläufigen Ergebnis kam, dass die Schutzwirkung gegen die Sars-CoV-2-Variante B.1.351 "minimal" ist, setzte die südafrikanische Regierung den Einsatz des Impfstoffs aus. Eine weitere Studie soll Aufklärung bringen.
Abschreiben sollte man Astrazeneca noch nicht. Die nach der Impfung gebildeten Antikörper erkannten immer noch Teile der Virus-Variante und blockierten sie, sagte Sarah Pitt vom britischen Institute of Biomedical Science der Deutschen Welle. Pei-Yong Shi von der University of Texas Medical Branch sagte, vielleicht werde man einen sehr geringen Krankheitsverlauf haben, aber es sei viel besser, als nicht geimpft zu sein.
Laut "Ärztezeitung" weist Sabri Mahdi von der Universität Witwatersrand in Südafrika auf Studien des Herstellers Johnson & Johnson hin, bei dessen Wirkstoff es sich ebenfalls um ein vektorbasiertes Vakzin handle. Auch dieser Wirkstoff sei bei moderaten Verläufen weniger wirksam gewesen, habe aber vor Hospitalisierungen und tödlichen Verläufen geschützt. Es sei daher möglich, dass beide Impfstoffe eine ähnliche Immunantwort induzierten.
Auch Kombi-Mutante beherrschbar
Karl Lauterbach hat recht, wenn er vor der Möglichkeit warnt, es könnten auch noch Mutanten kommen, gegen die die aktuell zugelassenen Impfstoffe nicht mehr wirken. Doch noch ist es nicht so weit. Die sogenannte brasilianische Variante P1 wütet zwar aktuell fürchterlich in Brasilien und steckt auch von einer ersten Infektion Genesene erneut an. Doch dies liegt vermutlich an den gleichen Mutationen, wie sie B.1.351 aufweist. Umso erfreulicher ist es, dass Mauricio Zuma, Produktionschef des biomedizinischen Instituts Fiocruz, mit Bezug auf eine neue Studie mitteilte, das Astrazeneca-Vakzin sei gegen P1 wirksam.
Auch die kürzlich in Deutschland erstmals aufgetauchte "Kombi-Mutante" B.1.525 ist eher noch kein resistentes Virus, auch wenn es die Mutationen von B.1.1.7, P1 und B.1.351 vereint. Epidemiologe Timo Ulrichs sagte ntv, auch bei dieser Variante sei die Wirkung der Impfstoffe vermutlich abgeschwächt. Aber sie sei immer noch hoch genug, um eine Herdenimmunität erzielen zu können.
Hersteller können schnell nachlegen
Falls doch neue Impfstoffe nötig werden, können sie die Hersteller voraussichtlich schnell bereitstellen. Sie alle arbeiten bereits daran, ihre Vakzine anzupassen. "Für mRNA-Impfstoffe geht man von sechs Wochen aus, dass ein neuer Impfstoff generiert werden kann", sagte UKE-Infektiologin Marylyn Addo in einer Videokonferenz. "Ich bin selber kein Impfstoff-Hersteller, aber ich würde sagen, zwei bis drei Monate mit regulatorischer Anpassung ist wahrscheinlich eine realistische Timeline."
Dafür werden in Deutschland oder Europa auch keine Neuzulassungen nötig sein, sondern die bestehenden Mittel könnten um die Komponenten erweitert werden, mit denen die Wirkstoffe zur Anpassung ergänzt werden, sagte Klaus Cichutek, Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts. Ebenso seien keine neuen, umfassenden Studien nötig. Es gäbe derzeit bereits Gespräche und Vorschläge der Europäischen Kommission zu einer Angleichung der gesetzlichen Regelungen.