Im Tier oder im Menschen?Wie Omikron entstanden sein könnte
 Von Hedviga Nyarsik
Von Hedviga Nyarsik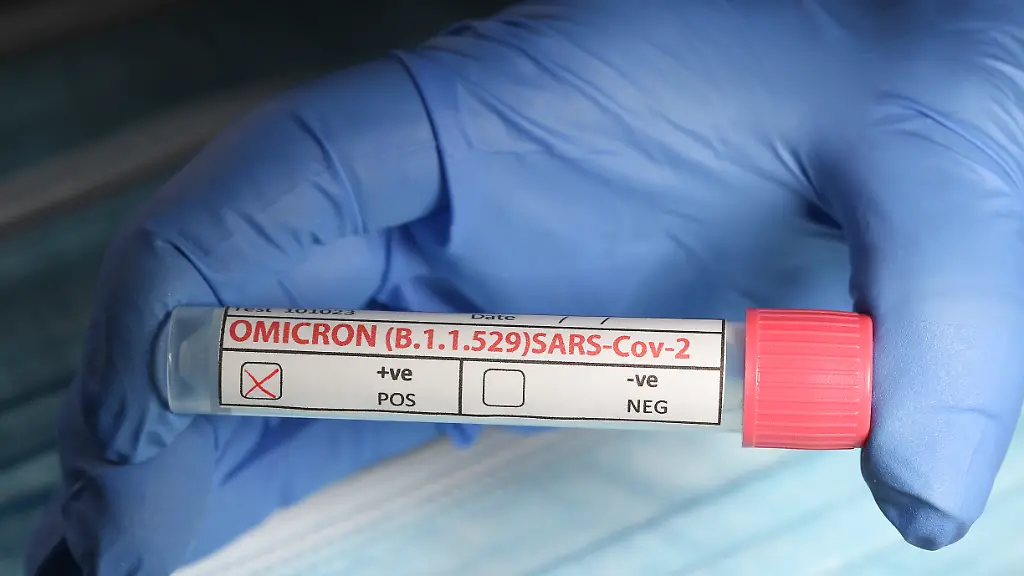
Noch ist wenig über die neue Corona-Variante Omikron bekannt, die sich derzeit in Südafrika ausbreitet und bereits weitere Teile der Welt erreicht hat. Dennoch gibt es bereits mehrere Theorien, wie die Mutante entstanden sein könnte.
Die neue Corona-Variante Omikron versetzt Expertinnen und Experten weltweit in Alarmbereitschaft. In Südafrika, wo die Mutante das erste Mal nachgewiesen wurde, jagt sie innerhalb kürzester Zeit die Infektionszahlen nach oben. "Es ist noch etwas mysteriös, wie Omikron plötzlich aus dem Nichts kam", sagte Jörg Timm, Leiter des Instituts für Virologie am Universitätsklinikum Düsseldorf, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Entstanden ist die Virus-Variante allerdings nicht allzu plötzlich. Der Stammbaum von Omikron reicht mehrere Monate zurück, wie Daten der Nextstrain-Datenbank zeigen, in die Ergebnisse zu Virus-Sequenzierungen aus der ganzen Welt einspeist werden.
"Nach derzeitigem Kenntnisstand hat sich eine frühe Form von Omikron schon vor der Entstehung von Alpha und Delta als eigener Virustyp entwickelt", sagt Wolfgang Preiser von der Stellenbosch University in der Nähe von Kapstadt der Nachrichtenagentur dpa. Er ist Mitglied des Forschungskonsortiums, das die Variante entdeckt hat. Omikron sei nicht aus einer der früheren besorgniserregenden Varianten entstanden, sondern habe sich vermutlich parallel über mehrere Monate unbemerkt weiterentwickelt, so der Forscher. "Die Frage ist: Wieso blieb Omikron so lange verborgen und legt erst jetzt los? Fehlten noch ein, zwei Mutationen, um sich schnell verbreiten zu können?" Die ältesten bekannten Nachweise der Variante stammen aus der ersten Novemberhälfte.
Der genaue Ursprung der Omikron-Variante bleibt bislang aber ein Rätsel. Dennoch gibt es verschiedene Theorien, wie die Mutante entstanden sein könnte. Ein Überblick:
Theorie 1: Der tierische Wirt
Einige Forscherinnen und Forscher gehen davon aus, dass das Virus schon im Frühjahr 2020 ein Tier infiziert haben könnte - beispielsweise ein Nagetier. In diesem tierischen Wirt saß der Erreger eine ganze Zeit quasi fest und konnte ungestört mutieren.
Dass Sars-CoV-2 auch immer wieder auf Tiere überspringt, beobachteten Experten bereits früh in der Pandemie. So hatten dänische Forscherinnen und Forscher im vergangenen Jahr etwa eine mutierte Version des Coronavirus bei Nerzen nachgewiesen, mit der sich zahlreiche Menschen infiziert hatten. Daraufhin töteten Behörden Millionen Nerze, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Auch in den USA konnten Wissenschaftler einen Corona-Ausbruch unter Weißwedelhirschen nachweisen, die sich gern in der Nähe von menschlichen Siedlungen aufhalten. Somit ist es durchaus möglich, dass auch Omikron sich in einem solchen tierischen Reservoir gebildet haben könnte, und nach einigen Monaten zum Menschen zurückgesprungen ist.
Theorie 2: Langzeit-Infizierte
Die einzigartigen Mutationen der Omikron-Variante könnten aber genauso gut in einem menschlichen Organismus entstanden sein. Vor allem in immungeschwächten Menschen - zum Beispiel in HIV-Erkrankten - beobachten Forscherinnen und Forscher, dass das Virus monatelang im Körper bleiben kann. So kann es sich über viele Monate vermehren und Stück für Stück verändern, ohne dass es gänzlich vom Immunsystem ausgeschaltet wird. Alex Sigal vom Africa Health Research Institute in Durban erklärt die These im "Spiegel" so: "Das Virus wohnte die ganze Zeit in einer einzelnen Person und entwickelte sich weiter, bis es genügend kritische Masse oder Mutationen hatte, um andere Menschen infizieren zu können."
Im Sommer berichteten Forschende in einer Studie über eine 36-jährige Person, die das Coronavirus 216 Tage in ihrem Körper trug. Ihr Immunsystem war durch eine schlecht eingestellte HIV-Infektion zu schwach, um das Virus zu besiegen. Gleichzeitig sei die Immunreaktion stark genug gewesen, um das Virus zu bedrängen, heißt es in der Studie. Es lernte mit der Zeit die Abwehrreaktion des Körpers kennen und konnte sich auf sie einstellen. So könnten nicht nur HIV-Erkrankte, sondern auch Patienten nach einer Organtransplantation oder generell Personen, deren Immunsystem geschwächt ist, zu Wirten für Virusmutationen werden.
"In der Vergangenheit hat man bei immunsupprimierten Menschen mit einer sogenannten chronischen Sars-CoV-2 Infektion - also einer Infektion, die über mehrere Wochen geht - beobachtet, dass sich das Virus über die Zeit hinweg verändert", bestätigte auch Adam Grundhoff vom Leibniz-Institut für Experimentelle Virologie die Annahme dem RND. "Ich halte es allerdings nicht für die wahrscheinlichste Hypothese, dass Omikron in einem Menschen mit einem unterdrückten Immunsystem entstanden ist."
Gegen diese Theorie spreche die Vielzahl an Mutationen bei Omikron. "In einem HIV-Infizierten oder einem anderen immunsupprimierten Patienten, der im Krankenhaus behandelt wird, würde ich vielleicht ein paar dieser Mutationen erwarten, aber nicht diese Menge", sagte Grundhoff. "Auch die Tatsache, dass diese Mutationen an Stellen liegen, die eine Immunflucht suggerieren, spricht gegen die Hypothese. Schließlich übt das unterdrückte Immunsystem von HIV-Erkrankten kaum Druck auf Coronaviren aus, eine Immunflucht zu entwickeln." Selbst bei Erkrankten, die mit Antikörpermedikamenten behandelt werden würden, sei nicht mit derart vielen Mutationen zu rechnen.
Theorie 3: Isoliert lebende Völker
Denkbar wäre außerdem, dass Omikron in einer Region entstanden ist, in der die Menschen weitestgehend abgeschnitten vom Rest der Welt leben. So vermutet die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek im "Spiegel", dass die Variante "aus einer Region stammt, in der man weniger sequenziert, und einfach nicht gesehen wurde". Sie verweist dabei auf die vielen Mutationen: "So etwas bildet sich nicht innerhalb von ein paar Tagen."
Diese Theorie favorisiert ebenfalls Virologe Christan Drosten von der Berliner Charité. "Ich gehe davon aus, dass es sich nicht in Südafrika entwickelt hat, wo derzeit viele Sequenzierungen durchgeführt werden, sondern irgendwo im südlichen Afrika während der Winterwelle", sagte er dem Science-Magazin. "Dort gab es lange Zeit viele Infektionen, und für die Entwicklung eines solchen Virus ist ein enormer evolutionärer Druck erforderlich."
Andere Expertinnen und Experten zweifeln allerdings auch an dieser Hypothese. So auch Andrew Rambaut: "Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich einen Ort auf der Welt gibt, der so isoliert ist, dass diese Art von Virus über einen so langen Zeitraum übertragen werden kann, ohne dass es an verschiedenen Orten auftaucht", zitiert das RND den Professor für Molekulare Evolution an der University of Edinburgh.
Ursprungsfragen schwierig zu klären
Ob tierischer Wirt, HIV-Patient oder isoliertes Völkchen - das alles sind bislang nur "spekulative Thesen und nicht belegt", merkt Omikron-Mitentdecker Preiser an. Es ist ebenso möglich, dass die Variante unter ganz anderen Umständen entstand, und keine der drei Theorien richtig ist. Denn Menschen mit gesundem Immunsystem können ebenfalls Wirte für Mutationen sein, wenn sie nur lange genug mit dem Virus infiziert sind.
Hinzu kommt, dass die Entstehung von Viren nur schwer zu bestimmen ist. Selbst beim ursprünglichen Coronavirus, das Ende Dezember 2019 im chinesischen Wuhan entdeckt wurde, ist die Ursprungsfrage immer noch nicht abschließend geklärt. Zwar hält es die Weltgesundheitsorganisation WHO für "sehr wahrscheinlich", dass das Virus in Fledermäusen entstanden ist. Doch bis heute melden sich immer wieder Expertinnen und Experten zu Wort, die diese Theorie anzweifeln, und stattdessen Beweise für einen Labor-Unfall sehen.