Bakterien, Viren, ParasitenNeuer Test spürt Erreger in Hirnflüssigkeit auf
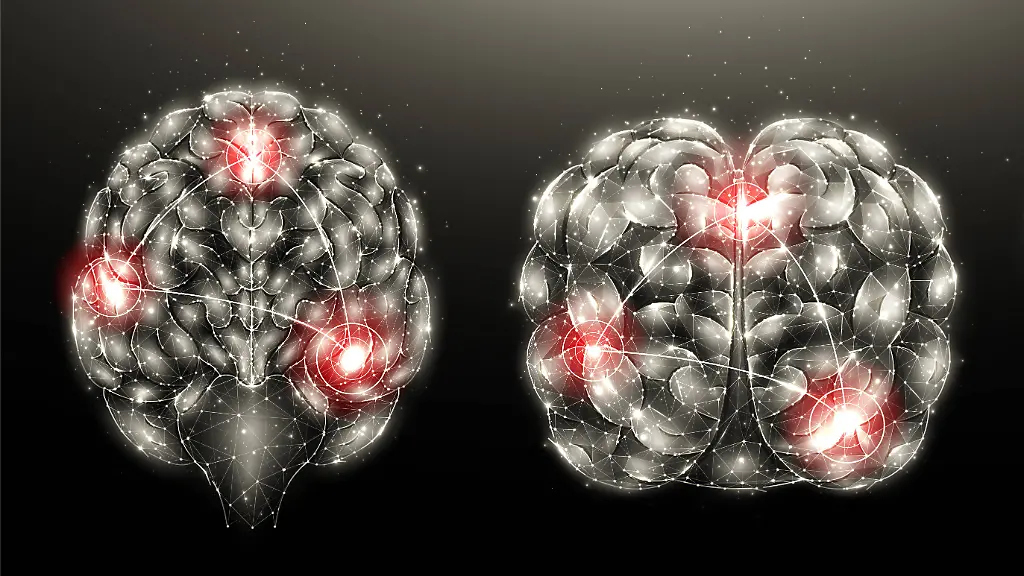
Eine Infektion des Zentralen Nervensystems kann schnell lebensbedrohlich werden. Doch oft lässt sich die Ursache nicht eindeutig feststellen. Forschenden gelingt es nun, nahezu alle bekannten Erreger mithilfe eines einzigen Tests zu identifizieren. Doch der Test weist noch einige Nachteile auf.
Ein Genomtest kann Hirnflüssigkeit auf nahezu alle bekannten Erreger überprüfen - sowohl Viren als auch Bakterien, Pilze und Parasiten. So könne man relativ zuverlässig die Ursache von Gehirninfektionen ermitteln und die passende Therapie einleiten, schreibt ein US-Forschungsteam nach einer Studie über sieben Jahre. "Indem wir viele Tests durch einen einzelnen Test ersetzen, können wir uns das langwierige Rätseln bei Diagnostik und Therapie sparen", sagte Studienleiter Charles Chiu von der University of California San Francisco. Chiu leitet das mikrobiologische Labor der Hochschule. Allerdings hat das Verfahren eine entscheidende Schwäche.
Infektionen des Zentralen Nervensystems (ZNS) wie etwa Meningitis, Enzephalitis und Myelitis können lebensbedrohlich sein, wie die Gruppe im Fachjournal "Nature Medicine" erläutert. Oft seien eine schnelle Diagnose und Behandlung entscheidend, um schwere Folgen abzuwenden. Derzeit kombiniere man zur Abklärung oft mehrere Testverfahren, dennoch lasse sich die Ursache etwa von Meningoenzephalitis in der Hälfte der Fälle nicht abklären.
"Dieses Thema ist extrem wichtig", bestätigte der Neurologe Helge Roland Topka, Chefarzt an der München Klinik Bogenhausen, der nicht an der Studie beteiligt war. Der Sprecher der Kommission Neurologische Notfallmedizin der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN) sprach von einer "faszinierenden Technik": "Dieses System ist in der Lage, auch solche Erreger zu finden, mit denen man nicht rechnet."
Vollautomatisiertes Verfahren
Das von Chiu mitentwickelte vollautomatisierte Verfahren - das sogenannte metagenomische Next-Generation-Sequencing (mNGS) - analysiert Proben der Hirnflüssigkeit auf verschiedene Erregertypen. Dabei wird im Hirnwasser zirkulierendes Erbgutmaterial isoliert und sequenziert. Anschließend werden diese Sequenzen mit Datenbanken abgeglichen und verschiedenen Organismen zugeordnet.
In der aktuellen Studie stellt das Team die Ergebnisse der Untersuchungen von Proben vor, die von 2016 bis 2023 an das Labor geschickt und dort untersucht worden waren. In jeder siebten (697 Proben; 14,4 Prozent) der insgesamt 4.828 Proben stellte die Auswertung eine Infektion fest. In fast der Hälfte (45,5 Prozent) davon fand das Team DNA-Viren, in gut 26 Prozent RNA-Viren, in knapp 17 Prozent Bakterien, in 8,5 Prozent Pilze und in knapp 3 Prozent Parasiten. Bei rund 1.160 Proben, die von der Universitätsklinik in San Francisco stammten, verglich das Team zudem verschiedene diagnostische Verfahren: Bei 22 Prozent der Proben ermittelte nur das neue Verfahren den verantwortlichen Erreger.
Hohe Spezifität, nicht so gute Sensitivität
Mit einer Rate von 99,6 Prozent bei der sogenannten Spezifität waren Fehlalarme äußerst selten. Deutlich schwächer war dagegen die sogenannte Sensitivität: Sie lag bei rund 63 Prozent - also nur bei knapp zwei Dritteln der Patienten und Patientinnen mit einer Gehirninfektion wurde tatsächlich ein Erreger ermittelt. Das sei aber immer noch deutlich besser als bei Antikörper-Tests, wo die Sensitivität nur 29 Prozent erreiche, und bei direkten Testverfahren auf bestimmte Erreger, die 46 Prozent erreichten, heißt es.
Dennoch schreibt die Gruppe: "Mit einer Gesamtsensitivität von 63,1 Prozent reicht das mNGS-Verfahren nicht aus, um konventionelle mikrobiologische Tests zu ersetzen." Ursache für die begrenzte Aufklärungsquote seien unter anderem Fälle, in denen das Nervensystem einem Erreger nur kurzzeitig ausgesetzt war - etwa beim West-Nil-Virus - oder aber Infektionen, bei denen die Auslöser nur bestimmte Teile des Gehirngewebes besiedeln und nicht in der Hirnflüssigkeit auftauchen.
Zu hohe Analysedauer
Die Hauptschwäche des Verfahrens für die Anwendung in der Notfallneurologie ist jedoch für den Münchner DGN-Experten Topka die Analysedauer von derzeit gut 3,5 Tagen. "Oft haben wir nur eine extrem kurze Zeitschiene, um eine Therapie einzuleiten. Bei einer bakteriellen Meningitis verschlechtert sich die Prognose pro Stunde um 30 Prozent." Da müsse man sofort reagieren - oft auf Verdacht. Zur Abklärung und anschließend optimierten Therapie nutze man gegenwärtig bereits einen Multiplex-PCR-Schnelltest, der die Hirnflüssigkeit binnen gut einer Stunde analysiere - allerdings lediglich auf etwa ein Dutzend der häufigeren Erreger.
Im Gegensatz dazu sei das von Chiu vorgestellte Verfahren auch in der Lage, "Erreger zu finden, nach denen man nicht gezielt sucht". Gerade bei rätselhaften Fällen ohne akuten Zeitdruck sei dies extrem wichtig.
Auch die Gruppe um Chiu hebt den Nutzen des Ansatzes hervor. Das gelte vor allem:
* für jene Erreger, die sich nicht im Labor kultivieren lassen, etwa das Borreliose-Bakterium Borrelia burgdorferi sowie Bartonella henselae, den Verursacher der Katzenkratzkrankheit
* zur Diagnose viraler Infektionen
* zur Abklärung seltener, aber äußerst gefährlicher Ursachen, wie der Amöbenenzephalitis oder der Schwimmbad-Amöbose
* sowie bei Ermittlungen im Fall von Krankheitsausbrüchen.
So habe die Methode nach einem Ausbruch einer pilzbedingten Meningitis in Mexiko 2023 bei dem ersten US-Patienten den Erreger Fusarium solani ermittelt und dadurch die US-Gesundheitsbehörden auf das Problem aufmerksam gemacht.
Seltene Erreger nehmen auch in Deutschland zu
Infektionen mit seltenen Erregern würden auch in Deutschland zunehmen, sagte Topka, insbesondere durch Fernreisen und den globalen Handel. Zur Abklärung rätselhafter Hirninfektionen sei der neue Ansatz durchaus hilfreich. "Wenn das Verfahren noch etwas schneller wäre, dann wäre das die Lösung für viele Infektionsprobleme", so Topka.
Die Kosten des Tests beziffert das Forschungsteam auf etwa 3.000 Dollar (knapp 2.800 Euro). Damit eigne sich das Verfahren zwar zunächst nur für wohlhabende Länder. Allerdings könnten die Kosten in Zukunft sinken.
Im Fachblatt "Nature Communications" stellt Chiu mit einem weiteren Team ein ähnliches mNGS-Verfahren vor: Dieses kann bei Infektionen der Atemwege die viralen Ursachen binnen eines Tages ermitteln. Hier liegt die Zuverlässigkeit der Resultate im Vergleich zum PCR-Standard demnach bei knapp 94 Prozent.