Hochansteckend, aber milder?Was die Wissenschaft über Omikron sagt
 Von Christian Herrmann
Von Christian Herrmann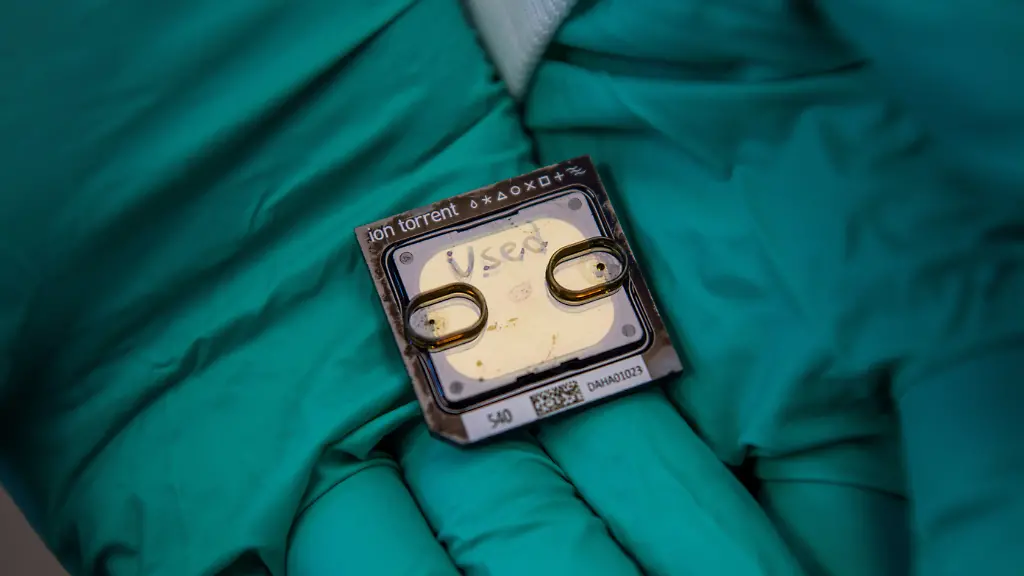
Omikron breitet sich rasend schnell auf der ganzen Welt aus. Schwere Verläufe bleiben selten, aber das ist kein Grund zur Entwarnung. Wissenschaftliche Modelle sagen für einzelne Länder Hunderttausende Infektionen täglich voraus, die Kliniken in die Knie zwingen könnten.
Es gibt in der Virologie eine populäre Theorie: Am Ende des 19. Jahrhunderts bricht eine Pandemie über die Menschheit herein und tötet zwischen 1889 und 1895 etwa anderthalb Millionen von damals ungefähr 1,5 Milliarden Menschen. 130 Jahre später lebt dieses Virus nach wie vor unter uns. Es handelt sich um OC43 - ein Humanes Coronavirus, das 1967 erstmals nachgewiesen wird und inzwischen eine zwar nervige, aber ungefährliche Erkältung verursacht. Das ist die Theorie von Viren, die mit der Zeit weniger gefährlich werden.
Das sei eine der möglichen Evolutionsrichtungen, hat Virologe und Epidemiologe Klaus Stöhr im ntv-Podcast "Wieder was gelernt" erklärt. Das Virus suche eine Balance zwischen zwei Extremen, Verbreiten und Schaden. "Dieses Equilibrium heißt für die meisten Erreger, den Wirt so weit wie möglich zufriedenzulassen", sagt der frühere Leiter des Influenza-Programms der Weltgesundheitsorganisation WHO. "Das erhöht die Chance, eine weitere empfängliche Person zu finden."
Einen Beleg dafür, dass die Pandemie vor 130 Jahren vom Erkältungsvirus OC43 ausgelöst wurde, gibt es nicht. Es existiert keine Probe des Erregers, der damals über die Erde hergefallen ist. Nichtsdestotrotz hoffen mehrere Wissenschaftler, dass wir diese Wandlung von tödlich zu mild derzeit beim Coronavirus beobachten können. Dass Omikron, die neue Variante von Sars-CoV-2, zwar ansteckender, aber gleichzeitig weniger gefährlich ist als Vorgänger wie Delta.
Reproduktion 70 Mal schneller als Delta
Zumindest der erste Teil dieser These scheint bereits bestätigt. Großbritannien hat am Mittwoch und am Donnerstag so viele Neuinfektionen wie noch nie innerhalb eines Tages verzeichnet. Die Zahl der Omikron-Fälle verdopple sich derzeit in weniger als zwei Tagen, sagte Premierminister Boris Johnson.
In Norwegen schlagen die Gesundheitsbehörden ebenfalls Alarm: Unkontrolliert könnte die neue Variante im neuen Jahr bis zu 300.000 Fälle täglich verursachen, warnen sie - bei nur 5,4 Millionen Einwohnern. Und auch der WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus warnt, dass sich Omikron mit einer Geschwindigkeit ausbreitet, "die wir bei keiner vorherigen Variante gesehen haben".
Eine neue Studie der Universität Hongkong stützt diese These. Demnach reproduziert sich Omikron in den ersten 24 Stunden nach einer Infektion in den Bronchien bis zu 70 Mal schneller als die Delta-Variante. Gleichzeitig haben die Wissenschaftler bei ihren Untersuchungen aber auch festgestellt, dass sich Omikron im Lungengewebe selbst bis zu zehnmal langsamer verbreitet als der Urtyp von Sars-CoV-2. Der hat sich dort von allen Varianten bisher am schnellsten reproduziert, also auch schneller als Delta. Das könne auf eine weniger gefährliche Krankheit hindeuten, fassen die Forscher ihr Ergebnis zusammen.
Südafrika meldet mildere Verläufe
Es ist eine Erkenntnis, die sich - Stand jetzt - mit der Realität in Südafrika deckt. Schon ganz am Anfang der Omikron-Welle ist dem medizinischen Personal in einer Klinik im Hotspot Pretoria aufgefallen, dass die Verläufe sehr viel milder waren als bei den ersten drei Wellen mit dem Urtyp von Sars-Cov-2, mit der Beta- und schließlich mit der Delta-Variante. Von insgesamt 42 Menschen, die am 2. Dezember auf der Corona-Station der Klinik behandelt wurden, mussten nur 30 Prozent beatmet werden. Nur ein Patient lag auf der Intensivstation.
Gestützt wird diese Einzelbeobachtung inzwischen von einer großangelegten Studie, bei der 78.000 südafrikanische Omikron-Fälle untersucht wurden. Demnach müssen Omikron-Infizierte 29 Prozent seltener ins Krankenhaus eingewiesen werden als Corona-Patienten, die sich in der ersten südafrikanischen Welle Mitte 2020 mit Sars-Cov-2 infiziert hatten. Und selbst diejenigen, die ins Krankenhaus kommen, müssen seltener auf die Intensivstation.
"Krankheitsschwere geringer ausgeprägt"
"Die Krankheitsschwere ist geringer ausgeprägt", hatte Christian Drosten bereits vergangene Woche in der ARD erklärt. "Wir können, einfach gesprochen, sagen: Pro Infektion geht nur ein Drittel der Fälle ins Krankenhaus, und wenn sie im Krankenhaus sind, dann haben sie auch nur ein Drittel der schweren Verläufe. Das wäre so eine Faustregel von dem, was man sieht", sagte der Berliner Virologe, bevor er einschränkte: "Wir wissen aber nicht ganz genau, wie das zu deuten ist."
Eine Vermutung ist, dass sich viele Menschen im noch weitgehend ungeimpften Südafrika in einer der ersten drei Corona-Wellen infiziert und auf diese Weise einen natürlichen Immunschutz aufgebaut haben. Das lässt sich abschließend erst sagen, wenn weitere Daten vorliegen. Aber auch in der EU fällt auf, dass alle 3158 bisher bekannten Omikron-Fälle entweder mild oder asymptomatisch verlaufen sind. Der einzige bekannte Todesfall ist europaweit ein britischer Patient. Geschlecht, Alter, Impfstatus und etwaige Vorerkrankungen sind allerdings unklar.
Infektions-Tsunami?
Es gibt Anzeichen dafür, dass Omikron weniger gefährlich ist als Delta. Das ist aber kein Grund zur Entwarnung, denn Omikron ist offensichtlich auch sehr viel ansteckender als die bisher dominierende Variante. Und das stellt ein neues Problem dar.
"Ein Virus, das weniger schädlich, aber hochansteckend ist, kann mehr Todesfälle verursachen als ein Virus, das hochschädlich, aber nicht so ansteckend ist", warnen zum Beispiel die Forscher aus Hongkong. Ähnlich äußert sich WHO-Chef Adhanom Ghebreyesus. Die schiere Zahl der Infektionsfälle könne Gesundheitssysteme in die Knie zwingen, sagt er. Demnach könnte sich Omikron nicht zu einer neuen Infektionswelle auftürmen, sondern zu einem Tsunami, der Krankenhäuser und Kliniken niederwalzt.
Veranschaulicht wird das von einem Modell, das für das Vereinigte Königreich 400.000 bis 700.000 Neuinfektionen täglich voraussagt. Wenn sich ein Virus mit der Reproduktionsrate von Omikron oder Delta ausbreiten könne, müsse man in Großbritannien mit 30 bis 40 Millionen weiteren Infizierten rechnen, hat Epidemiologe Dirk Brockmann von der Berliner Humboldt-Universität diese Woche bei einer Veranstaltung des Science Media Center erklärt. Das ließe sich auch auf Deutschland übertragen.
Die Impfstoffe wirken
Aber wir stehen diesem Tsunami nicht schutzlos gegenüber. Ja, die Impfstoffe schützen vor Omikron nicht mehr so gut wie vor Delta und Alpha und anscheinend auch nicht mehr so lange. Aber nach wie vor scheinen sie das Schlimmste zu verhindern. Die großangelegte Studie in Südafrika hat ergeben, dass eine zweifache Biontech-Impfung einen 70-prozentigen Schutz vor einem schweren Verlauf bietet, der im Krankenhaus enden würde. Mit Booster-Impfung ist der Schutz noch mal größer.
Auch diese Erkenntnis deckt sich mit der Realität auf den Intensivstationen. Angelique Coetzee hat im südafrikanischen Omikron-Hotspot Pretoria als eine der ersten Ärztinnen Omikron-Patienten behandelt und vergangene Woche bei CNN bestätigt, dass 90 Prozent der Intensivpatienten immer noch ungeimpft sind. "Sehr, sehr wenige Geimpfte kommen ins Krankenhaus." Mittlerweile gibt es Anzeichen dafür, dass die Omikron-Welle im südafrikanischen Hotspot ihren Höhepunkt überschritten hat.
Neue Vakzine und Tabletten
Das Beste, was man aktuell machen kann, ist, weiter Maske zu tragen, Abstand zu halten, für frische Luft zu sorgen und sich impfen zu lassen. Und wer das schon doppelt gemacht hat, holt sich besser heute als morgen einen Booster ab. Vermutlich im Frühjahr oder Sommer noch einen zweiten und im nächsten Herbst einen dritten. Dann vielleicht schon mit einem neuen, speziellen Omikron-Impfstoff, der bereits in Planung ist. Und wen es dann trotzdem erwischt, der kann vielleicht auf eine Covid-Tablette setzen, die in klinischen Studien auch gegen Omikron beeindruckt und Krankenhauseinweisungen zu 90 Prozent verhindert hat - und auf ihre Zulassung zusteuert.
Unter anderem Christian Drosten blickt deshalb trotz Omikron optimistisch in die Zukunft. Corona werde in ein oder zwei Jahren einem normalen Erkältungsvirus ähneln, hat er in der ARD getippt. Und vielleicht bestätigen, was wir bei OC43 nicht mehr nachweisen können: dass Coronaviren mit der Zeit weniger gefährlich werden.