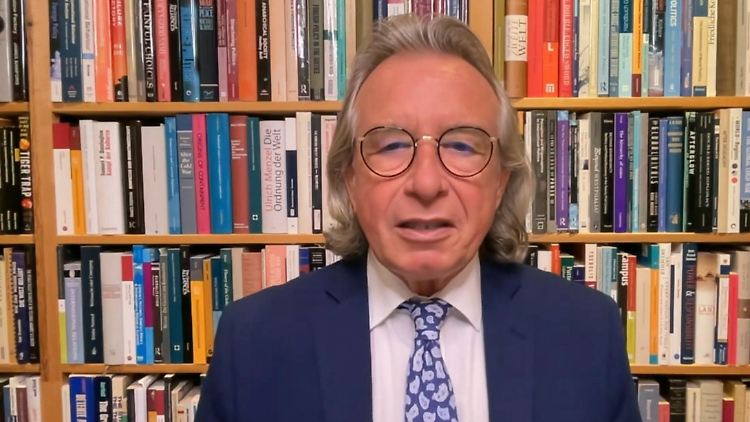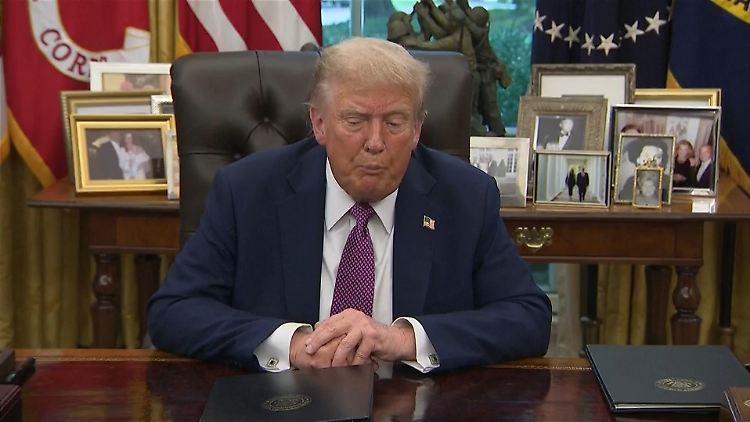No pasarn 70 Jahre Bürgerkrieg
16.07.2006, 14:13 UhrAn diesem Dienstag jährt sich der Ausbruch des Spanischen Bürgerkrieges (1936-1939) zum 70. Mal. Eigentlich sollte zu diesem Datum schon längst ein Gesetz zur Wiedergutmachung für die Opfer der späteren Franco-Diktatur (1939-1975) vorliegen. So hatte es Spaniens Ministerpräsident Jos Luis Rodrguez Zapatero, selbst Enkel eines im Krieg hingerichteten republikanischen Hauptmanns, zu Beginn seiner Amtszeit versprochen. Doch die sozialistische Regierung hat den entsprechenden Entwurf noch nicht einmal fertig gestellt, geschweige denn im Parlament eingebracht. Heikler als erwartet hat sich nämlich die Auseinandersetzung mit diesem düsteren Kapitel der Geschichte des Landes erwiesen.
In Spanien, wo noch Dutzende Plätze und Straßen nach dem "Generalsimo" Franco oder anderen Größen seines Regimes benannt sind, hat es so etwas wie Vergangenheitsbewältigung nicht gegeben. Um den friedlichen Übergang zur Demokratie nach dem Tod des Diktators 1975 zu gewährleisten, einigten sich die Parteien auf eine Art Pakt des Schweigens.
Die konservative Opposition wirft Zapatero nun vor, diesen Konsens brechen zu wollen und alte Wunden aufzureißen. "Die Franco-Zeit ist Geschichte und sollte dies auch bleiben", meint die Volkspartei (PP). Die Regierung ist dagegen überzeugt, dass dies der Versöhnung nicht dient. "Nicht das Vergessen heilt die Wunden, sondern die Wahrheit", sagt der sozialistische Abgeordnete Ramn Juregui. Die Sieger des Bürgerkrieges hätten ihre Gefallenen damals geehrt, den unterlegenen Republikanern sei dies verwehrt geblieben. "Es ist noch eine Schuld zu begleichen."
"In Europa ist Spanien die einzige Demokratie, die aus einer Diktatur hervorgegangen ist, ohne mit dieser juristisch zu brechen", schrieb die Zeitung "El Pas". Genau dies verlangen aber immer mehr Opfer-Verbände. So auch die Organisation Nizkor. "Früher oder später wird Spanien einsehen müssen, dass es nach dem Vorbild Deutschlands oder Italiens die Gesetze der Diktatur und die Unrechtsurteile gegen Franco-Gegner für null und nichtig erklären muss, denn das Regime war illegal", sagt ihr Vorsitzender Gregorio Dionis.
Der Untergang der Zweiten Republik und der Beginn des "Bruderkampfs" zwischen den "zwei Spanien", dem der "roten" Republikaner und dem der letztlich siegreichen faschistischen Militärs unter Franco, war am 18. Juli 1936 durch eine Militärrevolte der in Marokko stationierten spanischen Armee gegen die demokratisch gewählte Volksfrontregierung eingeleitet worden. Die Führer des Aufstandes bildeten eine Junta, die Franco zum nationalspanischen Regierungs-und Staatschef ausrief. Später sollte er sich als "Caudillo" (Führer) von "Gottes Gnaden" feiern lassen.
Das Gemetzel dauerte 978 Tage. Bis heute ist unklar, wie viele Menschen in den Kriegsjahren ums Leben kamen. 600.000 waren es nach immer noch unvollständigen Untersuchungen. Denn die meisten Militär-Archive sind für die Forscher weiter verschlossen. Hinter den Frontlinien sollen mindestens 80.000 Menschen der Unterdrückung und den Erschießungskommandos der Franquisten und weitere 50.000 den "Hinrichtungskomitees" der Republikaner zum Opfer gefallen sein.
Die Putschisten brachten damals zwar schnell ein Drittel des Landes unter ihre Kontrolle. Doch die Republik leistete mit Hilfe der Volksmilizen erbitterten Widerstand. In einer beispiellosen Welle der Solidarität und mit Unterstützung der Sowjetunion kämpften an ihrer Seite bis zu 60.000 Freiwillige aus 60 Ländern, die Internationalen Brigaden. Ernest Hemingway setzte ihnen in seinem Roman "Wem die Stunde schlägt" ein literarisches Denkmal. Aus dieser Zeit stammt auch der Ruf "No pasarn" (Sie werden nicht durchkommen). Geprägt hatte ihn die kommunistische Abgeordnete Dolores Ibarruri, die als Symbolfigur des Widerstands auch den Beinamen "La Pasionaria" (Die Leidenschaftliche) trug.
Kriegsentscheidend war die starke militärische Unterstützung Francos durch Hitler-Deutschland (rund 15.000 Soldaten) und das Italien Mussolinis (50.000). Eines der dunkelsten Kapitel stellte die Bombardierung der baskischen Stadt Guernica durch Kampfflugzeuge der deutschen "Legion Condor" am 26. April 1937 dar. Unter den rund 7000 Einwohnern der völlig wehrlosen Stadt gab es bis zu 2000 Tote und 1000 Verletzte.
Zwar hat das spanische Parlament 2006 gegen die Stimmen der konservativen Opposition zum "Jahr der Erinnerung" an die Opfer erklärt. Doch dies geht vielen von ihnen längst nicht weit genug. "Wir brauchen keine moralische Rehabilitierung, sondern eine Verurteilung des Franco-Regimes", klagt Dolores Cabra, die einer Vereinigung ehemaliger Widerstandskämpfer angehört. Die Zeit drängt, denn die Überlebenden werden immer weniger: "Fast scheint es, als warte die Regierung, bis wir alle tot sind und sich das Thema von selbst erledigt hat."
Von Jörg Vogelsänger, dpa
Quelle: ntv.de