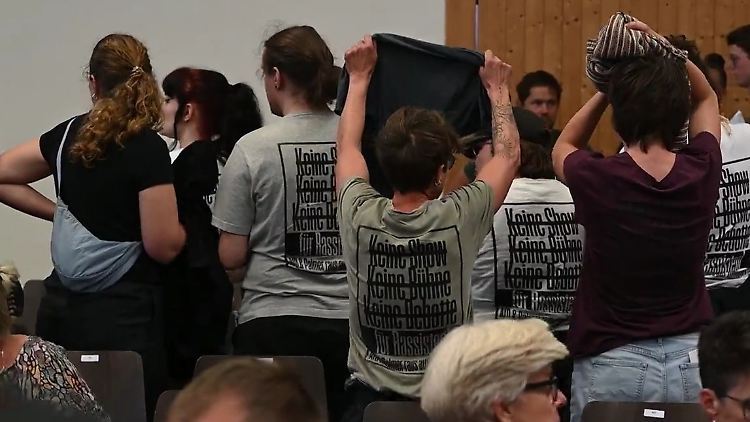Moderne Sklaverei Ausgebeutet und betrogen
23.08.2007, 18:54 UhrVor 200 Jahren verabschiedete Großbritannien das erste Gesetz zur Abschaffung des Sklavenhandels. Vor zehn Jahren erklärte die UNESCO den 23. August schließlich zum "Internationaler Tag zur Erinnerung an den Sklavenhandel und an seine Abschaffung". Heute ist sie in allen Staaten gesetzlich abgeschafft. Doch noch immer leben und arbeiten Menschen in Unfreiheit und unter schlimmsten Bedingungen. Beate Andrees, Expertin der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), kennt das Problem aus nächster Nähe.
Frau Andrees, was verstehen Sie unter "moderner Sklaverei"?
Sklaverei ist ursprünglich dadurch gekennzeichnet, dass ein Mensch einen anderen besitzt - im rechtlichen Sinne. Das gibt es heute nicht mehr. Dafür haben sich andere Systeme der Anwerbung von Arbeitskräften entwickelt, beispielsweise Menschenhandel und traditionelle Formen der Schuldknechtschaft. Allerdings ähneln ausbeuterische Arbeitsverhältnisse wie Zwangsarbeit, Zwangsprostitution oder Schuldknechtschaft heute weniger der Sklaverei und Gefangenschaft von damals, sondern nehmen vielmehr sehr subtile Formen der Abhängigkeit an. Ihre Methoden sind alle Formen von Zwang und Täuschung, ihr Zweck die Ausbeutung.
In welchen Ländern herrschen sklavenähnliche Arbeitsverhältnisse?
Grundsätzlich sind alle Länder betroffen. Unser Wissen über entsprechende Fälle steigt mit jedem Tag, auch dank der zunehmenden medialen Aufmerksamkeit, die dem Thema zukommt.
Können Sie Beispiele nennen?
In Brasilien beispielsweise lassen Farmen, die im Amazonas-Gebiet Bäume abholzen, billige Arbeitskräfte aus den ärmeren Provinzen im Norden anwerben und über Jahre hinweg ausbeuten. Schon bevor diese Menschen den ersten Baum schlagen, haben sie so hohe Schulden bei den Anwerbern, dass sie aus ihrem Arbeitsverhältnis gar nicht mehr heraus kommen und selbst nach Jahren keinen Pfennig verdient haben. Inzwischen nutzt die brasilianische Regierung Satellitenbilder, um zu sehen, wo die Abholzungen geschehen. Dann fliegen mobile Inspektionsteams ein, die verbrecherische Arbeitgeber vor Ort zu Entschädigungszahlungen und sogar Gefängnisstrafen verurteilen können.
Oft geraten die Menschen aus Armut in Zwangslagen. Gibt es andere Faktoren, die Zwangsarbeit und Menschenhandel begünstigen?
Zwischen der gestiegenen Mobilität der letzten Jahrzehnte und dem Menschenhandel besteht ein klarer Zusammenhang. Gleichzeitig sind legale Einwanderungsmöglichkeiten eher beschränkt worden, so dass es im Grenzverkehr einen großen Spielraum für illegale Netzwerke gibt. Aber auch traditionelle Lebensverhältnisse können Schuldknechtschaft begünstigen.
In welcher Hinsicht?
In Indien oder Pakistan beispielsweise haben Kastenlose gar keinen Zugang zum formellen Arbeitsmarkt – rechtlich schon, aber nicht in der kulturellen Praxis. Solche Traditionen und Bräuche lassen sich nur schwer verbieten, solange sich der Wandel in den Köpfen noch nicht vollzogen hat. Wir haben in Nigeria Fälle dokumentiert, wo junge Frauen mit Voodoo-Kulten getäuscht und an ihre Menschenhändler gebunden werden. Wenn sie dann in Europa zur Prostitution gezwungen werden, haben sie Angst auszubrechen.
Inwiefern werden in Deutschland die Menschenrechte von Arbeitnehmern verletzt?
Sklavereiähnliche Praktiken treten hier oft in informellen Wirtschaftszweigen auf, in Subunternehmerketten oder in versteckten Arbeitsbereichen wie Haus- oder Sexarbeit. In der Bau- oder Landwirtschaft stößt man auf skrupellose Unternehmer, die sich hinter so genannten Schein- oder Briefkastenfirmen verstecken. Diese Subunternehmer werben mit falschen Versprechungen häufig Menschen aus Osteuropa an, die dann in Deutschland feststellen müssen, dass ihnen die Hälfte ihres Lohnes für irgendwelche fiktiven Kosten abgezogen wird, dass ihre Pässe eingezogen werden, oder dass man ihnen droht, sie bei der Polizei zu denunzieren, falls sie keine Überstunden machen.
Wie viele Menschen leben in Deutschland in erzwungenen Arbeitsverhältnissen?
Es gibt hier keine verlässlichen statistischen Zahlen. Wir haben aber 2005 eine globale Studie durchgeführt und kamen in den industrialisierten Ländern auf 360.000 Menschen, davon 270.000 Opfer von Menschenhandel. Das ist allerdings eine Mindestschätzung, da wir ja nur die Fälle erfassen können, die auch tatsächlich dokumentiert wurden. Auf der Basis von BKA-Statistiken und anderen bekannten Fällen sind wir in Deutschland auf eine Zahl von 15.000 Menschen gekommen. Die Zahl zeigt, dass es hier zwar nicht um Millionen von Fällen geht, aber um eine Zahl, die groß genug ist, um tätig zu werden.
Mit welchen Konsequenzen müssen ausbeuterische Arbeitgeber rechnen?
Das Parlament hat im Jahr 2005 das Gesetz zur Zwangsprostitution durch einen neuen Gesetzesparagrafen ergänzt, der die Ausbeutung von Arbeitskräften, etwa in der Landwirtschaft oder im Bausektor, mit einbezieht. Mit dem neuen Paragrafen fällt Ausbeutung jetzt nicht mehr unter das Arbeitsrecht, sondern unter das Strafrecht und kann damit Gefängnisstrafen nach sich ziehen.
Was passiert mit den Opfern?
Nach dem neuen Gesetz werden die Opfer, die sich meist illegal in Deutschland aufhalten, nicht mehr kriminalisiert. Sie haben jetzt Anspruch auf eine Bedenkzeit, um zu entscheiden, ob sie im Strafrechtsverfahren als Zeugen auftreten und Entschädigungsansprüche geltend machen wollen. Allerdings haben die Opfer von Ausbeutung in der Land- oder Bauwirtschaft fast keine Möglichkeiten, sich Rat zu holen oder Unterschlupf zu finden. Wir benötigen mehr so genannte niedrigschwellige Hilfsangebote, also Einrichtungen, zu denen sich die Opfer auch hintrauen, und wie es sie im Bereich der Prostitution bereits gibt.
Ist der Staat in der Hauptverantwortung?
Die Einhaltung von Menschenrechten ist ganz klar eine Staatsaufgabe. Insofern gilt ein großer Teil unserer Aufmerksamkeit der Gesetzesarbeit. Wir versuchen, Staaten zu beraten, damit sie bessere Gesetze erlassen und die dann auch tatsächlich anwenden.
Welche Verantwortung trägt jeder Einzelne als Konsument?
Das ist eine sehr wichtige Frage, schließlich gibt es diese Arbeitsverhältnisse auch deshalb, weil wir als Käufer eine Nachfrage erzeugen. Lebensmittelunternehmen arbeiten immer häufiger mit Subunternehmern zusammen, haben also überhaupt keinen Kontakt mehr zu den Arbeitnehmern auf dem Feld und drücken die Preise so massiv, dass das Zuliefererunternehmen rein mathematisch gar keine normalen Löhne zahlen können. Aber keiner fragt, wie die billigen Preise zustande kommen, wer den Salat oder die Erdbeeren pflückt. Hier sind die Konsumenten natürlich in der Verantwortung.
Was müsste international geschehen, um die Situation zu verbessern?
Es müsste noch viel mehr Aufklärungsarbeit geleistet werden, auch in Ländern, in denen die Medien das Thema bisher noch nicht thematisiert haben. Und solange es Gesetzeslücken gibt, wird es auch skrupellose Menschen geben, die sie ausnutzen. Um die Umsetzung zu gewährleisten, müssen Arbeitsinspektoren ausgebildet werden, es braucht spezielle Polizeieinheiten und Hilfsorganisationen.
Der 23. August erinnert an den Aufstand der Sklaven auf Santo Domingo, der heutigen Dominikanischen Republik und Haiti, der ein Signal für den Abschaffungsprozess gab. Gehen auch heute die Impulse von den Betroffenen aus?
Wir legen bei unserer Arbeit sehr viel Wert darauf, dass die Opfer in ihren Rechten gestärkt werden, etwa durch Gewerkschaftsarbeit oder Hilfsangebote. Gleichzeitig sind die Ausbeutungsverhältnisse heute aber oft so komplex und so subtil, dass viele gar nicht wissen, in was sie hineingeraten. In der Prostitution kann es passieren, dass sich Frauen mit ihrem Zuhälter identifizieren, ihn sogar für ihren Freund halten. Und Kinder werden oft so früh in schreckliche Arbeitsverhältnisse hineingezwungen, dass man gar nicht erwarten kann, dass sie sich aus eigener Kraft daraus befreien können. Doch wir haben heute, anders als vor 200 Jahren, universell anerkannte Menschenrechte. Insofern muss die Initiative eben auch von oben kommen.
Mit Beate Andrees sprach Nona Schulte-Römer
.
Quelle: ntv.de