Hintergrund Der Streit um die Jobcenter
06.02.2010, 12:30 UhrDie Zeit drängt: Nur noch bis Jahresende bleibt Zeit, die Betreuung der mehr als 6,5 Millionen Hartz-IV-Empfänger und ihrer Familien verfassungsrechtlich wasserdicht zu machen. Seit das Bundesverfassungsgericht 2007 die in den Jobcentern praktizierte Mischverwaltung beanstandete, wird über eine Neuregelung gestritten. Die Fronten verlaufen selbst innerhalb der Union.
Worum geht es?
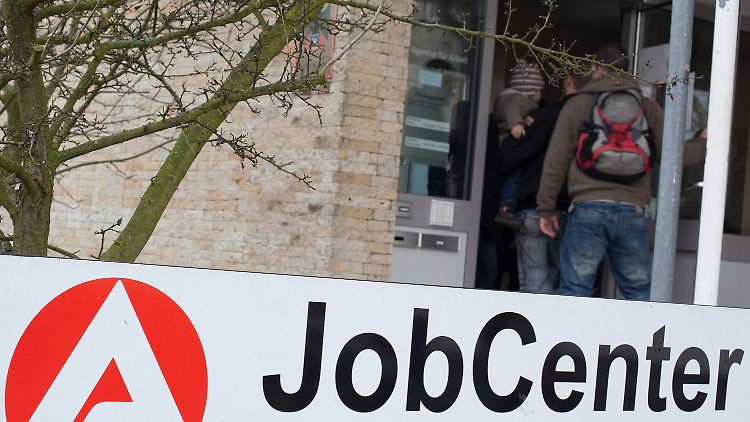
(Foto: dpa)
Langzeitarbeitslose und ihre Familien werden seit dem Start der Hartz-IV-Arbeitsmarktreform Anfang 2005 in sogenannten Jobcentern betreut. Dabei handelt es sich um 345 Arbeitsgemeinschaften (Argen), die von Kommunen und Arbeitsagenturen gemeinsam betrieben werden. Sie beendeten das Nebeneinander von Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe, bieten Betreuung unter einem Dach und aus einer Hand an.
Die Union setzte im Zuge der Reform noch durch, dass 69 Städte und Landkreise - sogenannte Optionskommunen - die Betreuung und Vermittlung von Langzeitarbeitslosen in Eigenregie in die Hand nehmen durften. Dieses - bis Ende 2010 befristete - Modell hat noch keine gesicherte rechtliche Basis. Daneben gibt es noch 23 Kommunen, in denen Arbeitsagenturen und örtliches Sozialamt wie früher ihre Aufgaben getrennt wahrnehmen.
Was heißt "Betreuung aus einer Hand"?
Die Jobcenter vereinen Sozialamt und Arbeitsagentur. Die Mitarbeiter sind - nach erheblichen Anfangsschwierigkeiten - zuständig fürs Arbeitslosengeld II, sie vermitteln Jobs oder verhängen Sanktionen gegen Arbeitsunwillige und kümmern sich um ergänzende Leistungen wie Wohnung und Heizung, aber auch um akute Alltagsnöte wie Kinderbetreuung oder Schuldner- oder Suchtberatung. Alle Leistungen werden in einem Bescheid bewilligt.
Was hat die Verfassungsrichter gestört?
Mit der Zusammenarbeit von Kommunen und Bundesagentur für Arbeit (BA) in den Jobcentern entstand nach ihrer Auffassung eine grundgesetzlich unzulässige Mischverwaltung. Die Bürger hätten ein Recht darauf, zu erfahren, welche Stelle - Kommune oder Bundesagentur - für welche Entscheidung zuständig ist.
Woran scheiterte ein erster Lösungsversuch?
2009 legte der damalige Bundesarbeitsminister Olaf Scholz (SPD) einen Kompromiss vor, auf den er sich mit den Ministerpräsidenten der Länder verständigt hatte. Dieser sah eine Änderung des Grundgesetzes vor, um die einheitliche Hartz-IV-Verwaltung erhalten zu können. An die Stelle der Argen sollten öffentlich-rechtlich organisierte "Zentren für Arbeit und Grundsicherung" treten.
Doch die Union im Bundestag spielte nicht mit: Sie lehnte den Kompromiss ab, der unter Mitwirkung ihrer eigenen Ministerpräsidenten zustande gekommen war und der den Optionskommunen eine grundgesetzlich abgesicherte Bestandsgarantie gebracht hätte. Man könne kein verfassungswidriges Gesetz durch eine Grundgesetzänderung heilen, lautete die Begründung.
Was will die neue Bundesregierung?
Nach dem Scheitern der Kompromisslösung legte die neue Bundesministerin Ursula von der Leyen (CDU) Ende Januar ein Konzept vor, das die hohen Hürden einer Grundgesetzänderung umgehen soll. Die Aufgaben von Kommunen und Arbeitsagenturen werden organisatorisch getrennt, beide Behörden sollen aber unter einem Dach auf freiwilliger Basis weiter kooperieren. Hartz-IV-Empfänger erhalten wieder zwei Leistungsbescheide, im Idealfall aber in einem Kuvert.
Warum legen sich die Länder quer?
Die Kritiker befürchten ein neues Verwaltungschaos zulasten der Langzeitarbeitslosen, sollten die Jobcenter zerschlagen werden. Zudem drohe mehr Bürokratie: Ob jemand arbeitsfähig ist, soll zwar wie bisher die Bundesagentur entscheiden. In Streitfällen bekommt aber ein Gremium von Krankenkassen, Kommune, Arbeitsagentur und Rentenversicherung das letzte Wort. Kommt es dabei zum Streit soll ein internes Schlichtungsverfahren die Lösung bringen.
Hessens Ministerpräsident Roland Koch (CDU), der zuletzt massiv Front gegen von der Leyens Pläne machte, will mit seinen Mitstreitern letztlich den Einfluss der BA zurückdrängen. Ihnen kommt es darauf an, dass mehr Kommunen die Option erhalten, die Betreuung alleine zu regeln: Ohne lästige Abstimmung mit der BA. Es geht dabei wie immer auch ums Geld.
Quelle: ntv.de, Günther Voss, dpa







