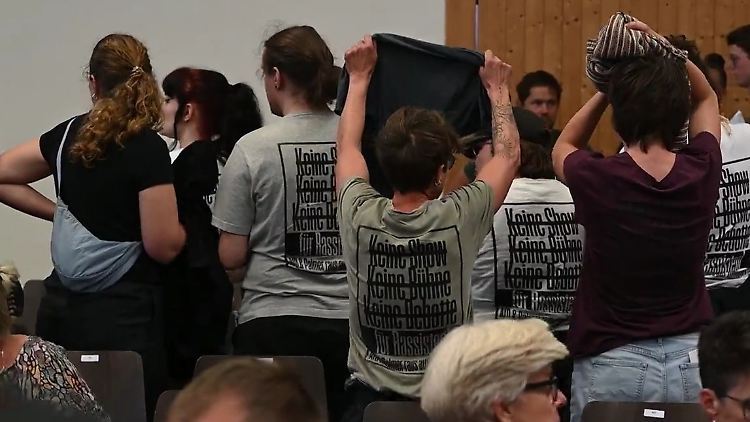Marianne Birthler wird 60 Diktatur-Debatte nicht zu Ende
22.01.2008, 06:00 UhrDie Hüterin der Stasi-Akten, Marianne Birthler, kann stur sein. Forderungen nach zügiger Auflösung der Behörde für die Stasi-Unterlagen lehnt die frühere DDR-Bürgerrechtlerin beharrlich ab: Für einen Abschluss sei es viel zu früh, sagt Behördenchefin Birthler, die an diesem Dienstag (22. Januar) 60 Jahre alt wird. Sie will den speziellen Apparat zur Aufarbeitung der Papiere aus dem DDR-Ministerium für Staatssicherheit (MfS) mindestens bis 2019 - dem 30. Jahrestag der friedlichen Revolution vom Herbst 1989 - erhalten. Nach einem Konzept von Kulturstaatsminister Bernd Neumann (CDU) sollen die Stasi-Akten mittelfristig jedoch in das Bundesarchiv kommen.
"Geschichtsklitterer und Geschichtslügner"
"Künftige Generationen sollen ein realistisches Bild über die DDR mitnehmen. Die SED-Diktatur war kein ostdeutsches Regionalphänomen, sondern Teil der deutschen Nachkriegsgeschichte" unterstrich Birthler in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur dpa. Spektakuläre Enthüllungen seien aus den Akten zwar nicht mehr zu erwarten. Doch Bildungsangebote gerade für Schulen würden verstärkt gebraucht, sagt die Beauftragte auch mit Blick auf öffentliche Auftritte von früheren Stasi-Größen. "Sie sind weiterhin keine Zeitzeugen, sondern Geschichtsklitterer und Geschichtslügner."
Die Sorge der früheren Grünen-Politikerin ist, wie ihre Behörde mit rund 1100 Mitarbeitern in der Berliner Zentrale und gut 800 in den ostdeutschen Außenstellen besser gegen das Unwissen bei Jüngeren und das Verdrängen bei Älteren halten kann. Obwohl nach Ansicht von Birthler die DDR-Auseinandersetzung jetzt ernsthafter geführt wird, belegen jüngste Studien, wie mangelhaft das Wissen ostdeutscher Schüler zur DDR-Geschichte ist.
Abwicklung wäre "falsches Zeichen"
Rückenstärkung bekam Birthler nun von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die sich für den langfristigen Erhalt der Behörde aussprach. Das deutsche Modell sei auch Vorbild für andere Staaten, die sich bei der Aufarbeitung ihrer Vergangenheit daran orientierten, hatte Merkel dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" gesagt. Jetzt einen Beschluss zur Abwicklung zu fassen, wäre das "falsche Zeichen". Doch Stein des Anstoßes war wiederholt, dass die Behörden-Forscher die ungeschwärzten Papiere studieren können, während für außenstehende Wissenschaftler Einschränkungen gelten.
Birthler, die im Oktober 2000 das Amt von Joachim Gauck übernahm, agierte nicht immer ganz glücklich. Die Kritik sei teilweise berechtigt gewesen, musste sie zugeben. Zuletzt warfen ihr Kritiker "Sensationshascherei" beim Kampf für den Erhalt der Behörde vor. Ihre Behörde hatte ein Dokument zum Schießbefehl an der innerdeutschen Grenze just zum 46. Jahrestag des Mauerbaus am 13. August 1961 als neu verkauft, obwohl Auszüge aus dem Papier schon 1997 veröffentlicht worden waren. Sie sei nicht zu hundert Prozent auf dem Laufenden gewesen, musste die Behördenchefin eingestehen. Zurückrudern musste sie auch nach der Bundestagswahl 2005. "Nicht sehr glücklich" seien ihre Äußerungen über mögliche Stasi-Zuträger unter den Linkspartei-Bundestagsabgeordneten gewesen.
"Nichts unter den Teppich kehren"
Hartnäckigkeit bewies Birthler aber im langen Streit um die Herausgabe von Stasi-Abhörprotokollen über Altkanzler Helmut Kohl (CDU). Schon als Grünen-Politikerin war Birthler ihrem Vorsatz gefolgt: "Es darf nichts unter den Teppich gekehrt werden." Bundesweit für Aufsehen hatte sie 1992 gesorgt, als sie aus Protest gegen die früheren Stasi-Kontakte von Brandenburgs damaligem Ministerpräsidenten Manfred Stolpe (SPD) aus der ersten brandenburgischen Landesregierung als Bildungsministerin zurücktrat.
Aufregung gab es auch 2004, als der damalige Innenminister Otto Schily (SPD) die Zuständigkeit für die Stasi-Unterlagenbehörde handstreichartig zur damaligen Kulturstaatsministerin Christina Weiss verlagerte. Birthler war zuvor nicht informiert worden. Trotzdem behielt sie öffentlich die Fassung. 2006 wurde sie vom Bundestag mit großer Mehrheit für fünf Jahre in ihrem Amt bestätigt.
Verdienst der Opposition
Birthler hatte schon Mitte der 80er Jahre als Mitarbeiterin der evangelischen Kirche in Ost-Berlin Kontakte zur Opposition. 1988 stieß sie zur "Initiative Frieden und Menschenrechte", einer der zur Wendezeit aktivsten Gruppen der DDR-Bürgerrechtsbewegung. Sie habe viele Menschen kennengelernt, die dem DDR-Regime widerstanden hätten, sagt sie. Es sei ein Verdienst der DDR-Opposition, dass es das Stasi- Unterlagengesetz gibt.
Von Jutta Schütz, dpa
Quelle: ntv.de