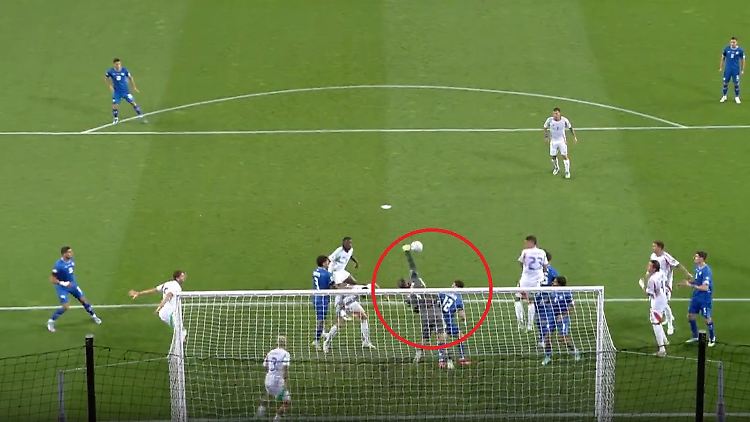Der ewige IOC-Präsident Juan Antonio Samaranch ist tot
21.04.2010, 13:59 UhrDer langjährige IOC-Präsident Juan Antonio Samaranch ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Der Spanier hatte das IOC von 1980 bis 2001 autokratisch geführt. Mit einer konsequenten Kommerzialisierung verhalf Samaranch der olympischen Bewegung zu einem enormen Macht- und Bedeutungszuwachs, machte sie aber auch anfällig für Korruption und Vetternwirtschaft.
Der frühere Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Juan Antonio Samaranch, ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Dies gab der behandelnde Arzt Rafael Esteban Mur nach Angaben der staatlichen spanischen Nachrichtenagentur EFE in Barcelona bekannt. Samaranch war in der katalanischen Metropole wegen einer akuten Herzschwäche auf der Intensivstation des Quirón-Krankenhauses behandelt worden.
Kurz vor seinem Tod hatten die Ärzte in einem Bulletin mitgeteilt, dass der frühere IOC-Präsident sich in einem "irreversiblen Schockzustand" befinde. Samaranch hatte von 1980 bis 2001 an der Spitze des IOC gestanden. Der Katalane wurde nach 21-jähriger Amtszeit vom Belgier Jacques Rogge abgelöst und zum Ehrenpräsidenten des IOC auf Lebenszeit ernannt.
Funktionär in Diensten Francos

Von Diktator Franco, unter dem sein Aufstieg als Sportfunktionär begann, hat sich Samaranch nie distanziert.
(Foto: AP)
Samaranch hatte bis kurz vor seinem Tod trotz seines hohen Alters ein hartes Arbeitspensum absolviert und im IOC hinter den Kulissen noch über einen erheblichen Einfluss verfügt. Er war schon seit mehreren Jahren gesundheitlich angeschlagen gewesen. 2001 wurde er in Lausanne wegen "extremer Erschöpfung" in ein Krankenhaus gebracht. Sechs Jahre später erlitt er in Madrid einen Schwächeanfall. Zuletzt wurde er im Herbst 2009 in Monaco wegen einer Ohnmacht in einem Krankenhaus behandelt.
Samaranch hatte dem Regime des Diktators Francisco Franco (1939-1975) als Staatssekretär für Sport, als Diplomat und Sportfunktionär stets loyal gedient. Seine Frau war eine Freundin von Francos Tochter Carmen, was Samaranchs Aufstieg nicht abträglich war. Die Diktatur unter Franco bezeichnete Samaranch rückblickend als "längste Periode von Wohlstand und Frieden, die unser Land seit Jahrhunderten erlebt hat". Zum gegen ihn erhobenen Vorwurf, er habe mit Mördern zusammengearbeitet, entgegnete er, das hätten "doch Tausende getan". Zudem habe kein Ausländer das Recht, "über mich zu urteilen, sondern nur das spanische Volk".
Konsequente Kommerzialisierung
1980, in der größten Krise der olympischen Bewegung, ließ sich Samaranch auf der IOC-Session in Moskau "mit Horst Dasslers (Chef von adidas, d. Verf.) Hilfe zum Präsidenten küren", wie die Journalisten Thomas Kistner und Jens Weinreich in ihrem Buch "Muskelspiele" schrieben. Als IOC-Chef schaffte Samaranch den Amateur-Paragrafen ab, ließ Profis zu den Spielen zu, baute das olympische Programm vor allem im Frauensport kräftig aus, ließ Sommer- und Winterspiele nicht mehr im selben Jahr veranstalten und führte die Paralympics für behinderte Sportler ein. Damit leitete er die konsequente Kommerzialisierung der olympischen Bewegung ein und verschaffte ihr einen enormen Geld-, Macht- und Bedeutungszuwachs. Samaranch formte den lange antiquierten Männerorden innerhalb von zwei Jahrzehnten zu einer milliardenschweren Bewegung.

1980, in der größten Krise der olympischen Bewegung, wurde Samaranch zum IOC-Präsidenten gewählt.
(Foto: AP)
Gleichzeitig machte Samaranch, dem seine Kritiker einen selbstherrlichen und diktatorischen Führungsstil vorwarfen, das IOC aber auch anfällig für die inzwischen weitverbreitete Korruption und Vetternwirtschaft in den Führungszirkeln. Die 1998 öffentlich gewordene Bestechung mehrerer IOC-Mitglieder zur erfolgreichen Beeinflussung der Wahl des Olympiaausrichters Salt Lake City für die Winterspiele 2002 warf einen Schatten auf Samaranchs Amtszeit. Zudem muss sich Samaranch nicht nachsagen lassen, den Kampf gegen Doping so konsequent vorangetrieben zu haben wie die Öffnung des IOC für den Kommerz.
Mit vielen seiner Landsleute versöhnte sich Samaranch, indem er 1986 maßgeblich dazu beitrug, dass seine Heimatstadt Barcelona den Zuspruch für die Ausrichtung der Olympischen Sommerspiele 1992 erhielt. Für seine Verdienste wurde er von Spaniens König Juan Carlos Anfang 1992 sogar geadelt.
Zuletzt hatte Samaranch die Bewerbung von Madrid für die Spiele 2012 und 2016 unterstützt, allerdings vergeblich. Als seinen größten Misserfolg nannte er aber im "Kicker" einmal die Tatsache, "dass das, was wir tun und erreicht haben, in der Öffentlichkeit nicht genug gewürdigt wird". Damit spielte er darauf an, nie für den ersehnten Friedensnobelpreis nominiert worden zu sein. Er wird Juan Antonio Samaranch für immer verwehrt bleiben.
Quelle: ntv.de, cwo/dpa/sid