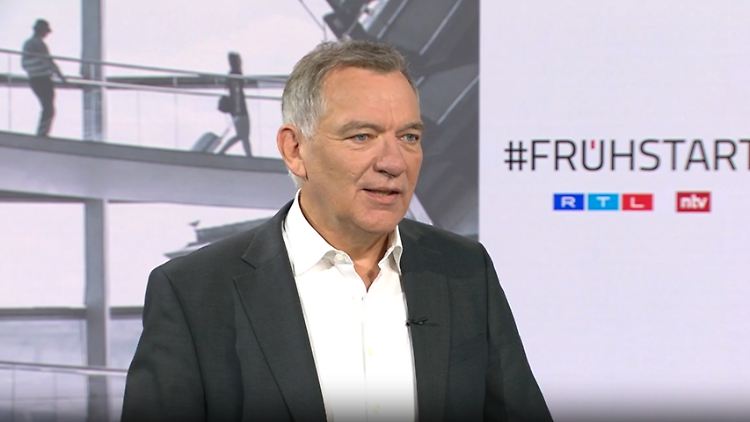Attentat von Arizona Die Früchte des Zorns
10.01.2011, 18:40 Uhr
Auf Halbmast: Die USA trauern um die Toten in Arizona und suchen zugleich nach den Gründen für die Tat.
(Foto: dpa)
Die tödlichen Schüsse von Tucson setzen die USA unter Schock, beschämt fragen sich Politiker, welche Verantwortung sie für das Attentat tragen. Von einem "Klima des Hasses" in der Politik ist die Rede. "Wir müssen die Waffen niederlegen", fordern Kommentatoren.
Wie massiv rhetorisch aufgerüstet worden ist, wurde im Vorfeld der Kongresswahlen deutlich. "Wenn wir nicht an den Wahlurnen gewinnen werden, was wird der nächste Schritt sein?", fragte die Republikanerin Sharron Angle bei ihrer Kandidatur für den US-Senat und brachte den zweiten Verfassungszusatz ins Spiel. In diesem ist das Recht eines jeden US-Bürgers auf Tragen einer Waffe garantiert – eine unverhohlene Anspielung also auf bewaffneten Widerstand gegen die demokratisch geführte Regierung von Präsident Barack Obama.
Oder Sarah Palin, ehemals republikanische Kandidatin für das Amt der Vizepräsidentin. "Nicht aufgeben – nachladen" schrieb die Ikone der konservativen Tea-Party-Bewegung im Wahlkampf um den Kongress im Internet und markierte auf einer Karte Wackelkandidaten der Demokraten mit einem Fadenkreuz. Auch Gabrielle Giffords war darunter, auf die nun in Tucson geschossen wurde. Die Kongressabgeordnete wurde schwer verletzt, sechs weitere Menschen starben.
Abgeordnete bewaffnen sich
Die Schüsse haben der politischen Klasse der USA einen Schock versetzt. Voller Entsetzen blicken Politiker beider Lager auf den blutigen Anschlag in Arizona und fragen sich, wie es so weit kommen konnte. Zwar gilt der mutmaßliche Attentäter Jared Lee Loghner als gestörter Einzeltäter. Doch nicht nur der zuständige Sheriff Clarence W. Dupnik spricht von einem "vergifteten Klima", das psychisch labile Menschen beeinflussen könnte. "Wir sind zu einem Mekka des Hasses und der Vorurteile geworden", sagte Dupnik unmittelbar nach der Tat. Die Härte und Heftigkeit der politischen Auseinandersetzungen macht er mitverantwortlich für den Anschlag. Wie andere Politiker der Demokraten kritisiert er insbesondere die Tea-Party-Bewegung für ihre martialische Wortwahl. "Meine Kollegen sind besorgt über das politische Klima, in dem sie operieren", sagte auch der demokratische Fraktionsgeschäftsführer Steny Hoyer im Sender CBS. "In den letzten zwei oder drei Jahren war die Atmosphäre viel wütender und konfliktfreudiger, als wir das bislang kannten." Einige Abgeordnete würden nun verdeckt Waffen mitführen, wenn sie vor Publikum auftreten. "Wir müssen die Waffen niederlegen", fordern deshalb liberale Kommentatoren wie Keith Olbermann von MSNBC.
Vertreter der Tea-Party und Republikaner weisen alle Vorwürfe in ihre Richtung zurück. Eine Mitverantwortung für die tödlichen Schüsse lehnen sie ab, sie verweisen auf den offenbar psychisch gestörten Einzeltäter. Ihre Reaktionen zeigen aber, dass sie sich ihrer selbst nicht so ganz sicher sind. Palin etwa entfernte die Karte mit den Fadenkreuzen prompt von ihrer Seite und sprach den Angehörigen der Opfer ihr Mitgefühl aus. Republikaner-Chef Michael Stelle war "schockiert und erschüttert", nachdem er im Wahlkampf noch politische Konkurrenten in die Schusslinie schicken wollte. Und im Repräsentantenhaus setzten die Republikaner eine geplante Debatte über die umstrittene Gesundheitsreform Obamas wieder ab, um der harten politischen Auseinandersetzung eine Pause zu gönnen.
Sog am rechten Rand
Vor allem der Streit um diese Reform war es, der das politische Klima in den USA nachhaltig vergiftet hat. Erst machte sich der Widerstand gegen Obamas Herzensprojekt vereinzelt auf Bürgerversammlungen Luft. Dann erwuchs unter den Händen einiger radikal-konservativer Strategen aus dem Unbehagen über Obamas Politik die Tea-Party-Bewegung, die mit brachialer Rhetorik die politischen Lager in die Schützengräben schickte. Die Gesundheitsreform wurde zum sozialistischen Teufelswerk erklärt, ein Erbe Nazi-Deutschlands. Und Obama wurde als Hitler-Karikatur dämonisiert, der ein "Todes-Gremium" (Palin) schaffen wolle. Die Auseinandersetzung gewann derart an Schärfe, dass es bei Diskussionsveranstaltungen nicht immer nur beim verbalen Schlagabtausch blieb.
Die republikanische Partei konnte und wollte sich dem Sog dieser radikalen Bewegung am rechten Rand nicht entziehen. Zu groß war die Gefahr, dass sich ihre Wähler eine neue Heimat suchen. Zu verführerisch die Aussicht, mit Hilfe der Gesundheitsreform Obama straucheln zu lassen. Der Erfolg bei den Kongresswahlen schien dieser Strategie recht zu geben. Doch überblendete er auch die Schäden, die dieser Weg hinterließ.
Denn die Befürworter der Gesundheitsreform waren zu Feinden geworden. Auch die Abgeordnete Giffords aus Arizona. Hassbriefe und Drohungen hagelten auf sie ein, ihr Wahlkreisbüro wurde verwüstet. Auf einer Veranstaltung tauchte sogar ein bewaffneter Mann auf, doch nichts passierte. Giffords sah die Gefahr der immer heftigeren Auseinandersetzungen und, als Palin ihre Karte mit den Fadenkreuzen ins Internet stellte, warnte sie: "Wer so etwas tut, muss wissen, dass dies Folgen haben kann."
Giftiges Arizona
Dass diese Folgen derart tragisch wurden, könnte nach Einschätzung von Beobachtern auch an der besonders giftigen Atmosphäre in Arizona liegen. Der Bundesstaat im Südwesten der USA grenzt an Mexiko, nach Ansicht vieler Bewohner ist die Lage dort wegen illegaler Flüchtlinge und Drogenschmuggels außer Kontrolle. Neben der Gesundheitsreform wird dort heftig um Einwanderungspolitik und Waffengesetze gestritten. So liberal wie in Arizona handhabt sonst kein Staat die Waffenpolitik. Und im vergangenen Jahr sollte das schärfste Einwanderungsgesetz der USA in Kraft treten, das aber gegen zahlreiche Anti-Diskriminierungsgesetze verstößt und auf Druck von Menschenrechtsorganisationen und dem Weißen Haus nun auf seine Verfassungskonformität überprüft werden muss. Die Auseinandersetzung darum hat die politischen Lager tief gespalten.
Nobelpreisträger und "New York Times"-Kolumnist Paul Krugman ist deshalb wenig überrascht von der Entwicklung. Für Krugman ist es nur konsequent, dass aus der hasserfüllten Sprache und aufgeladenen politischen Auseinandersetzung irgendwann praktische Taten erfolgten. Er spricht von einem "Klima des Hasses". Krugman verweist auch auf ähnliche Entwicklungen in Bill Clintons Amtszeit, als der aufgeheizten Stimmung gegen den demokratischen Präsidenten 1995 das Bombenattentat von Oklahoma folgte.
Krugman sieht nun allerdings auch die Chance auf Besserung gekommen. Das Attentat könne eine Zäsur sein und zur rhetorischen Abrüstung beitragen, hofft er ebenso wie andere Kommentatoren. Die Verantwortung dafür schiebt er den Republikanern zu, die den Ruf hören müssten. Sollten sie weitermachen wie bislang, befürchtet er dagegen, dass die Tat erst der Auftakt zu etwas viel Schlimmerem sein könnte.
Quelle: ntv.de