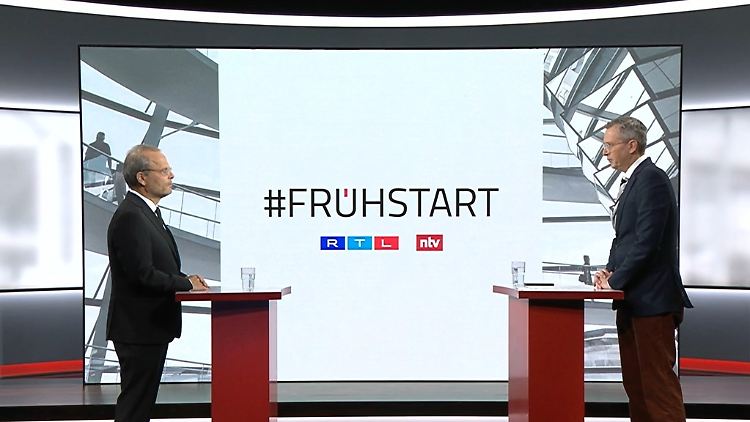Soziales Schulversagen Köhler rügt Ungerechtigkeit
29.11.2007, 08:49 UhrDie Ergebnisse der weltweiten Schulstudien IGLU und PISA haben eine heftige Debatte über die Konsequenzen im deutschen Bildungssystem ausgelöst. Angesichts der deutlichen Verbesserungen an deutschen Schulen warnten Bildungsexperten vor Selbstzufriedenheit. Zugleich entbrannte ein Streit zwischen Kultusministerkonferenz (KMK) und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) wegen der Interpretation der PISA-Daten. Die OECD veranstaltet den weltweiten Schultest.
Bundespräsident Horst Köhler rügte in scharfer Form die fehlende Chancengleichheit für Ausländerkinder und andere benachteiligte Familien. Dies sei eine "unentschuldbare Ungerechtigkeit" und "eine Vergeudung von Humanvermögen", sagte das Staatsoberhaupt in Berlin. Die Vernachlässigung von Talenten etwa aus Zuwandererfamilien werde die Gesellschaft "in Zukunft empfindlich spüren". Bei der Bildung dürfe niemand zurückgelassen werden. Jedes Kind müsse die bestmögliche Förderung erhalten.
Bei dem jüngsten PISA-Vergleich für 15-Jährige kam Finnland zum dritten Mal in Folge bei den Naturwissenschaften auf den ersten Platz. Deutschland verbesserte sich im Vergleich zu 2003 auf den 13. Rang und landete erstmals deutlich über dem OECD-Durchschnitt.
Streit um Vergleichbarkeit
Nach Angaben von OECD-Generalsekretär Angel Gurra ist aber "ein direkter Vergleich mit früheren Ergebnissen nicht möglich". Struktur und Schwerpunkte des Tests hätten sich stark verändert. Dennoch zeige sich, dass Länder wie Deutschland und Österreich deutlich besser geworden seien.
Der Sprecher des nationalen PISA-Konsortiums, Manfred Prenzel, hält dagegen die Ergebnisse von 2006 "sehr wohl mit denen von 2003 vergleichbar". Die Konzeption sei nur fortentwickelt worden. Lediglich Einstellungsfragen, so zum Verantwortungsgefühl für die Umwelt, seien hinzugekommen. Sie hätten aber "keinerlei Einfluss auf die Vergleichbarkeit der Ergebnisse".
KMK-Präsident Jürgen Zöllner (Berlin/SPD) sagte, die Länder vertrauten darauf, "dass PISA 2006 von der OECD in allen Teilbereichen methodisch einwandfrei konzipiert und durchgeführt wurde". Insbesondere müsse eine Vergleichbarkeit von Ergebnissen im Zeitverlauf sichergestellt werden.
Unions-Kultusminister gereizt
Die Bildungssprecherin der CDU/CSU-geführten Bundesländer, Karin Wolff (Hessen/CDU), forderte die Entlassung des OECD-PISA- Koordinators Andreas Schleicher. Mit den Aussagen über die Nicht- Vergleichbarkeit habe er eine unzulässige Kommentierung abgegeben. Ein Sprecher der OECD wies die Forderung zurück.
Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) warnte die Kultusminister vor "zu viel Euphorie". Die großen Probleme des Schulsystems seien bei weitem nicht gelöst, sagte GEW-Vizevorsitzende Marianne Demmer. Nach wie vor sei in keinem anderen vergleichbaren Industriestaat die Abhängigkeit zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg so groß wie in Deutschland. Nach Ansicht der Stiftung Lesen dürfen die Ergebnisse nicht "als bildungspolitisches Beruhigungsmittel missbraucht werden". Der Philologenverband sprach dagegen von einem "Beweis für die Innovationskraft und Reformfähigkeit" deutscher Schulen.
Beim PISA-Test für den Bereich Naturwissenschaften belegt Deutschland jetzt Rang 13 von 57 Staaten. Mit 516 Punkten rangieren die deutschen Zehntklässler allerdings deutlich hinter dem Weltbesten Finnland, der sich auf 563 Punkte steigern konnte. 30 Punkte entsprechen nach PISA-Lesart dem Lernfortschritt von einem Schuljahr. 2003 hatte Deutschland 502 Punkte erreicht und damit den 18. Rang belegt. Der OECD-Durchschnitt beträgt 500 Punkte.
Nach Finnland folgen bei der PISA-Platzierung Hongkong, Kanada und Taiwan. Österreich erreicht mit 511 Punkten Platz 18 (vorher 23), die Schweiz fällt vom 12. auf den 16. Rang. Die PISA-Ergebnisse sollen offiziell am 4. Dezember präsentiert werden.
Quelle: ntv.de